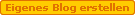Du bist nicht allein!
Um halb sieben schleiche ich mich an der Rezeption vorbei aus der Absteige – auf Nimmerwiedersehen! – und begebe mich zum Busplatz. Der Ausflug zum Huangshan wird eine typische Didus-Hammertour. Aber erst mal gilt es sich durch die Touristenhorden zu zwängen. Michael, ein Amerikaner aus Los Angeles, der auch schon länger in New York gelebt hat, nun in Xuzhou unterrichtet und mich beim Ausstieg aus dem Bus anspricht, will, dass ich mein Chinesisch einsetze, um den Uniformierten am überlaufenen Eingang zum Naturpark weiszumachen, irgendwelche Freunde, zu denen wir den Anschluss verloren hätten, seien bereits weiter vorn in der Schlange. Ich sage, dass ich für solche Aktionen zu ehrlich bin und glaube auch nicht, dass wir ohne Notlüge zwei Stunden anstehen müssen. Am Ende sind wir zwar nach einer Stunde durch, aber nun kommt noch eine halbe Stunde Busfahrt rauf zum Anstieg. Und dann muss ich am eigentlichen Eingang noch mal rund zwanzig Minuten rumstehen, weil ich erst hier die Eintrittskarte (umgerechnet 40 Mark) für den Berg bekomme. Ich finde aber den Eingang nicht. Wo ist denn hier der Eingang? Ich werde vom Ausgang zu einem Ort geschickt, wo gar kein Eingang ist. Da ist nur der Eingang zur Seilbahn, die noch mal 80 Yuan kostet. Seilbahn will ich nicht. Ich fühle mich wie ein Hund, der gleich von der Leine gelassen wird, aber Gleich verzögert sich immer wieder. Inzwischen ist es nach halb zehn! Wie viel Zeit soll ich hier eigentlich noch vertrödeln, bis ich endlich tun kann, weshalb ich hergekommen bin? Schließlich verliere ich mal wieder die Geduld (der Hund reißt sich von der Leine los), klettere durch Büsche, mache einen etwas gewagten Sprung auf eine Wasserdurchlassbefestigung und finde mich in der Schlange zur Seilbahn wieder. Kurz darauf finde ich endlich den Aufstieg zur Treppe. Meine Eintrittskarte hat nun gar keiner kontrolliert. Endlich geht es bergauf, ich mache ordentlich Tempo. Natürlich rächt es sich später, dass ich beim Aufstieg einfach jeden der eine Million Chinesen überholen will, die ebenfalls auf dem Weg nach oben sind.
Man darf nicht davon ausgehen, dass das hier eine normale Bergtour ist, denn die gesamte Strecke ist mit Treppenstufen versehen und auf denen tummelt sich die besagte (gefühlte) Million Chinesen. Außerdem liegen überall verstreut an den Rändern der Wanderwege teure Hotels und Camping-Nischen. Hier ist man nie allein! Auch nicht auf den Spitzen dieses auf einzigartige Weise von der Natur, von Sturm, Nebel und Regen, in bizarre Felsformationen gemeißelten Gebirges mit seinen insgesamt 72 verschieden hohen Gipfeln. Eine Attraktion ist der Nordsee genannte Aussichtspunkt mit Blick auf den so genannten Pinsel: einen steil emporragenden Felsen, aus dem ein Bäumchen wächst. Die Kombination sieht aus, als würden zwei Finger einen Pinsel halten. Ich überzeuge mich persönlich davon, dass der Vergleich nicht hinkt. Auf dem Rote-Wolken-Gipfel mache ich Rast, mit dem Hellen Gipfel erreiche ich den höchsten zugänglichen Punkt (1840 m).

Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Der von mir anvisierte Lotosgipfel, der eigentliche Höhepunkt (1864 m), ist gesperrt. Was ich auch noch nicht weiß: Auf dem Weg dorthin verengt sich der vorformatierte Wanderweg beträchtlich, weshalb ich mich plötzlich in einer Riesenschlange wiederfinde. Es geht sogar durch einige Höhlenschächte. Aber man stelle sich das vor: Auf dem Weg zu einem Gipfel in 1800 Metern Höhe steckt man plötzlich in einer Menschenmenge fest, als gäbe es Freikarten für Bayern gegen Real! Na, immerhin hatte ich kurz vor diesem Schock meinen Clooney-Auftritt und durfte gleich mehrfach vor traumhafter Kulisse posieren. Schade, dass einem als Clooney kein VIP-Durchlass gewährt wird. Aber – Moment! – kommt noch! Denn nachdem ich am gesperrten Aufstieg zum Lotosgipfel noch mal kurz Pause gemacht habe, blicke ich talwärts und was sehen meine schreckensstarren Augen? Noch mal Schlange ohne Ende! Das ist die Chance für meine notorische Ungeduld, endgültig mit mir durchzugehen. Als ich wieder festhänge und auch noch merke, dass die alle zur Seilbahn wollen, die ich gar nicht benutzen will (der Weg zu den tiefer gelegenen Treppen ist aber derselbe), erblicke ich unterhalb des Pfads, auf dem ich gerade im Stau stecke, total verödete und verlassene Stufen: ein offenbar gesperrter alternativer Abstieg. Ich wühle mich zurück und bin wild entschlossen irgendwie an der Holzgittertür vorbeizukommen, hinter der die verlassenen Stufen, die übrigens Herr-der-Ringe-Schauwert haben, beginnen. Aber – o Wunder! – muss ich gar nicht, denn das Schloss hängt zwar geschlossen vor dem Tore, nicht aber im Riegel, den ich mühelos zur Seite schieben kann, was ich auch tue. Mein Rucksack hängt in dem Spalt kurz fest, aber dann bin ich durch: allein treppab, ganz allein. So hatte ich mir die Bergtour eigentlich vorgestellt. Ich trippele in Windeseile hinunter, will ich doch wissen, ob die Sache nicht womöglich einen Haken hat und ich am Ende wieder zurück muss. Angesichts meiner schmerzenden Glieder und Gelenke wäre das freilich ein übler Ausgang des Experiments. Fakt ist: Es geht abwärts mit mir, in jeder Hinsicht. Von oben rufen ein paar Witzbolde mal wieder: „Hollo!“ Ich ignoriere das. Am Ende der Stufen treffe ich einen Gerüstarbeiter, der dabei ist, an einer steilen Felskante entlang eine Holzbrücke zu bauen. O Schreck, ich muss zurück, denke ich; und der wird mich gleich noch gehörig anfahren, was ich hier mache. Chinesen finden aber im Gegensatz zu Deutschen Ausländer auf krummen Extratouren cool und er zeigt mir, dass die Treppe über mir weitergeht. Ich bedanke mich, steige empor, komme zum Eingang der Seilbahn und KÖNNTE nun, wenn ich etwas weniger selbstgefällig und dafür etwas mehr mit Vernunft gesegnet wäre, einfach da einsteigen und meine schmerzenden Glieder dem verdienten Feierabend zuführen. Aber wie dereinst Boris, der immer den schwersten Schlag ausprobieren musste, wenn´s besonders aussichtslos zu werden begann, erkundige ich mich, wo es zu den Treppen ins Tal geht. Und nun beginnt für mich die wahre Zeit der Leiden, denn es wird ein quälend langer Abstieg über nicht enden wollende Stufen. Meine Kniekehlen schmerzen, die Waden haben schon mal einen Krampf angedroht und jetzt beginnt auch noch mein Kopf zu hämmern. Aber was sollen eigentlich die Männer sagen, die mir aus beiden Richtungen kommend, über den Tag verstreut immer wieder über den Weg gelaufen sind, Männer, die nicht zum Vergnügen die steilen Stufen rauf- und runterklettern, sondern die, ein massiv-hölzernes Joch auf den Schultern, von dem links und rechts zentnerschwere Lasten baumeln, Obst, Gemüse, Stoffe, auf eben diesen Stufen ihren Lebensunterhalt verdienen? Ich denke, dass es kaum einen treffenderen Ausdruck, kaum ein sinnfälligeres Bild geben kann für den krassen Gegensatz zwischen Arm und Reich im gegenwärtigen China als dieses absurd anmutende Nebeneinander von kapitalem Konsumtourismus und archaischem Arbeitsalltag. Vor allem muss ich freilich einsehen, dass man in meinem Alter seinem Körper nicht mehr solche Tours de force zumuten kann, ohne wenigstens eine vernünftige Mahlzeit einzunehmen. Äpfel und Birnen und ein paar Joghurt-Trünke, das war einfach nicht genug für diese Strapazen. Und die Gurke, die ich an einer der (denke, hoffe, flehe ich) letzten Rast-Stationen erwerbe, von denen es hier einige Dutzend gibt, bringt auch nur wenig Linderung. Bei jeder Stufe denke ich, mir platzt gleich der Schädel. Was ich total unterschätzt habe, ist die Anstrengung für die Muskulatur und die Gelenke, die mit dem Abstieg verbunden ist. Die Schwerkraft, dachte ich, die macht das schon. Ja, macht sie auch, sie macht sich tonnenschwer bemerkbar. Man muss sich das auch mal vor Augen führen: So ein Tag in den Gelben Bergen, das ist im Grunde nichts anderes, als würde man einen ganzen Tag lang die Stufen des Kölner Doms rauf- und runterpesen. Aber irgendwie leben ja Verrückte immer länger. Und so darf man sich auch nicht wundern, dass ich an der Busstation lieber noch mal 1200 Meter Stufen in Kauf nehme, als für eine Busfahrkarte Schlange zu stehen. Mehr als weh tun konnte die letzte Meile schließlich auch nicht mehr.
Ich bin nervös und habe es eilig, weil die Dämmerung einbricht und ich 2004 in China schon mal zu spät von einem Berg gekommen bin. Damals gab es keine Busse mehr. Diesmal habe ich mehr Glück. Der Bus, zu dem der Bergbus im Obertal mich gebracht hat (beim Einstieg gab es zwischen übermüdeten Chinesen eine heftige Rangelei), setzt mich dann zwar gleich an der nächsten Tankstelle wieder aus, aber er verweist mich auf einen anderen Bus, der dort im Halbdunkel parkt. Der ist allerdings total leer. Was wird das wieder werden? Die Jungs am Bus telefonieren. Ich verstehe nichts. Dann fahren sie los und auf halber Strecke werde ich noch mal umgeleitet. Dieser Bus (Nummer sechs an diesem Tag) bringt mich dann endlich sicher nach Hause.
Wenn ich jetzt was Ordentliches esse, denke ich, wird es sicher besser. Direkt neben dem Bus-Bahnhof ist so ein typisches chinesisches Kleinrestaurant: dürftige Ausstattung, gute Küche. Ich erkundige mich nach den Mahlzeiten und bestelle eine Ladung gebratenen Reis und die chinesische Spezialität Rührei mit Tomate für insgesamt drei Mark zwanzig. Der stolze Papa, der die Bestellung aufnimmt, bringt seine Tochter (englischer Name: Alice) ins Spiel. Die Oberschülerin soll bei mir ihr Schulenglisch an den Mann bringen. Englisch sei ihr Lieblingsfach, erklärt sie mir, aber an eine Elite-Uni wie Nanjing werde sie es wohl nicht schaffen. Mit Hilfe ihres Papas plane ich den morgigen Tag: Ein Bild des malerischen Ortes Hongcun (UNESCO-Weltkulturerbe) hängt nämlich im Restaurant an der Wand. Morgen Früh um zehn gehe der letzte Bus.
In der Jugendherberge lerne ich Chao aus Xian kennen, einen von fünf Zimmergenossen, die zum Glück alle früh schlafen gehen. Chao hat mit einem Freund oder einer Freundin zwei Tage (mit Übernachtung) in den Gelben Bergen verbracht. Zugegeben, das klingt vernünftig, aber ich hätte dann am Ende doch nur zwei Hammertouren daraus gemacht!