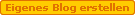Freitags bei "Celiu"
 Zum Frühstück schickt die arbeitende Bevölkerung uns in ein Restaurant, das berühmt ist für eine örtliche Delikatesse. Dabei handelt es sich um Riesenravioli in der Form und Größe des Raumschiffs Enterprise, die gefüllt sind mit einer Krabbensuppe. Man beißt den runden Nudelteig an der Seite leicht an wie ein feindliches Klingonengeschoss und schlürft, was das Zeug hält. Dabei darf das Raumschiff natürlich nicht abstürzen, sprich vom Teller fallen. Eigentlich bin ich noch satt von gestern Abend, aber jetzt wird hier nicht schlapp gemacht!
Zum Frühstück schickt die arbeitende Bevölkerung uns in ein Restaurant, das berühmt ist für eine örtliche Delikatesse. Dabei handelt es sich um Riesenravioli in der Form und Größe des Raumschiffs Enterprise, die gefüllt sind mit einer Krabbensuppe. Man beißt den runden Nudelteig an der Seite leicht an wie ein feindliches Klingonengeschoss und schlürft, was das Zeug hält. Dabei darf das Raumschiff natürlich nicht abstürzen, sprich vom Teller fallen. Eigentlich bin ich noch satt von gestern Abend, aber jetzt wird hier nicht schlapp gemacht!
Zur Verdauung flaniere ich mit Celiu ein bisschen durch die bescheidene Einkaufszone dieser 600.000-Einwohner-Stadt (Celiu sagt „Dorf“), in der jetzt am Vormittag natürlich nicht gerade der Bär tanzt. Danach geht es auf den Tempelberg, die wohl entscheidende Sehenswürdigkeit hier. Celiu lässt sich von ein paar Schnattertanten unten am Treppenaufgang überreden, buddhistische Räucherwaren zu erwerben. Sie will sie für ihren Papa verbrennen um die Götter, an die sie eigentlich nicht glaubt, aber man weiß ja nie, gnädig zu stimmen, der ja zuletzt nicht nur Glück hatte. Dabei verbrennt sie sich die Hand. Ein Zeichen, sage ich, mit ihren Göttern sei nicht viel los. Bei Jesus wäre so was nicht passiert und mächtiger ist er auch. Doch horch! Was klingelt dort? Es sind die Glöcklein oder Triangeln, die den Gottesdienst zur Mittagszeit einläuten. Wir geraten in ein buddhistisches Ritual mit viel Kling-kling und Klong-klong. Es wird viel gekniet und noch mehr ge-sing-sang-sungen. Die Mönche bieten uns hier vor ihrem Buddha eine richtige Show!
Unten am Fuße des Hügels ist so eine Art Saison-Jahrmarkt. Wir fahren Karussell und werfen Bälle in Eimer. Celiu hat sich in einen Bären verliebt, der fast so groß ist wie sie, aber sie wirft zu oft vorbei. Ich bin auch keine große Hilfe. Schließlich wird sie vollends wieder zu dem kleinen chinesischen Mädchen, das sie die meiste Zeit ihres Lebens in dieser Stadt ja war, indem sie vor dem völlig konsternierten jungen Mann auf der Stelle hüpft, quengelt und bettelt und mit quietschender Stimme wiederholt: „Ich will aber den großen Bären da.“ Ratlos bietet der junge Mann ihr diverse Geschenke auf dem Niveau von Kinder-Überraschungsei-Inhalten an. Sie schüttelt nur den Kopf. Entzückend ist sie in dieser Rolle und ich frage mich: Was ist hier kalkuliert und gespielt, was impulsives Verhalten? Der junge Mann von den Wurfeimern jedenfalls merkt rasch: Die wird er nicht wieder los. Er muss sich was einfallen lassen oder er verliert sein Gesicht. Celiu bekommt schließlich einen weißen Hund mittlerer Größe in die Hand gedrückt. Ich rate dringend dazu, den Köter anzunehmen. Wir streifen durch den Park, lassen uns von Polizisten im Müßiggang ablichten und machen Pause. Yangliu erzählt mir, dass sie manchmal von unerklärlichen Kummer-Attacken heimgesucht wird, obwohl sie sich natürlich immer fröhlich gibt, und fragt mich nach dem, was an ihr besonders sei. Ich sage: Willkommen im Leben.
Danach versucht es Celiu noch mal mit den Bällen, aber die fliegen immer wieder raus aus den metallenen Eimern. Es reicht nur für ein kolossal hässliches Stoffküken mit einer überdimensionalen Sonnenbrille. Wir nehmen einen Bus zurück, gehen schließlich die letzten paar Hundert Meter zu Fuß und überqueren eine Brücke über einen stinkenden Fluss.
Wieder zu Hause wandern wir zu Opa auf das Gemüsefeld hinterm Haus. Wie früher rupft er dort in den Rabatten und seine Enkelin erinnert sich daran, wie sie als Kind daneben saß und ihm zusah. Aber es erfüllt sie manchmal mit Sorge, dass Opa und Oma, die im Untergeschoss wohnen, noch so viel arbeiten müssen. Gerade in den letzten Jahren seien sie alt geworden, älter. Auch das bekümmere sie. Dafür studiere sie jetzt. Vielleicht könnte sie später viel Geld verdienen und Opa und Oma müssten nicht mehr arbeiten. Opa sieht allerdings eher so aus, als wäre das genau das Leben, das er nicht führen möchte. Wir wandern durch das Wohnviertel, das in der Tat etwas Dörfliches hat. Die meisten Häuser sind dreistöckig, schmal und hoch und grauweiß. Abgesehen von der in geschmacklosem Knallrosa erstrahlenden Villa von Herrn Neureich, an dem sogar die griechischen Säulen angestrichen sind wie Paulchen Panther. Zwischen den Wohnzeilen liegen Gemüsebeete und ein künstlicher See, etwa 1000 Quadratmetter groß, an dem sogar gewaschen wird. Ob die Wäsche danach wirklich sauberer ist? Überall begrüßt Yangliu Bekannte und an jeden Gruß fügt sie sogleich ungebeten die Erklärung an: „Das ist mein Lehrer!“, damit es keine dummen Fragen gibt oder – noch schlimmer – Missverständnisse. Mit einer steinalten Dame, die vor ihrem Haus Erben palt und Kräuter sortiert, spricht sie etwas länger. Die Greisin muss noch arbeiten, weil ihr Sohn Alkoholiker oder ein Nichtsnutz oder beides ist und sie nicht versorgen kann.
Am Abend wird gemeinsam diniert. Ein Cousin, Onkel und Tanten sind gekommen. Der Cousin, 13 Jahre alt, ist leicht übergewichtig und schwer computerzentriert. Er sitzt, seit er satt ist, vor dem Computer und spielt und als er später weg ist, muss ich es auch noch spielen, das beliebte Computerspiel „Pflanzen gegen Zombies“. Darin muss man mit Bomben schmeißenden Gemüsesorten oder explodierenden Kirschen sein trautes Heim vor hirnlos heraneilenden Zombies retten. Der letzte Schrei! Na dann gute Nacht!