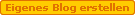| |
Die Stadt, die nicht endet - Teil 2
 Schanghai ist zwar die Stadt, die nicht endet, aber meine Zeit hier endet heute. Freilich reise ich nicht übereilt ab – das wäre dem nach dem ausgedehnt langen Abend (Abschiedsessen) gestern dringend nötigen Entspannungsprogramm, sprich Ausschlafen, auch abträglich gewesen –, sondern treffe mich, das ist ja schon fast Tradition, mit ehemaligen Studentinnen aus meiner YUST-Zeit. Diesmal ist der Jahrgang 01 dran. Programmpunkt eins: ein Abstecher zur Hafenpromenade am Fluss Huangpu (Foto) mit Blick auf den legendären Turm in Pudong, dem Manhattan Schanghais. 2004 war ich übrigens noch zu Gast im damals höchsten Wolkenkratzer des wie aus dem Nichts erwachsenen Stadtteils und aß ein Eis an einem Fenster mit Aussicht. Aber wo ist der Kratzer, das höchste Gebäude Chinas, denn jetzt nur geblieben? Ex-Studentin „Stella“, die übrigens nach drei Jahren mit ihrer Dauerwelle und der fehlenden Brille, vielleicht auch wegen des lackierten Handtäschchens nicht wiederzuerkennen ist, klärt mich auf: Inzwischen steht direkt nebenan ein neuer Wolkenkratzer, der siebzig Meter höher ist. Da fällt „mein“ Wolkenkratzer, der Jin-Mao-Turm, kaum noch auf. Sic transit gloria mundi! Schanghai ist zwar die Stadt, die nicht endet, aber meine Zeit hier endet heute. Freilich reise ich nicht übereilt ab – das wäre dem nach dem ausgedehnt langen Abend (Abschiedsessen) gestern dringend nötigen Entspannungsprogramm, sprich Ausschlafen, auch abträglich gewesen –, sondern treffe mich, das ist ja schon fast Tradition, mit ehemaligen Studentinnen aus meiner YUST-Zeit. Diesmal ist der Jahrgang 01 dran. Programmpunkt eins: ein Abstecher zur Hafenpromenade am Fluss Huangpu (Foto) mit Blick auf den legendären Turm in Pudong, dem Manhattan Schanghais. 2004 war ich übrigens noch zu Gast im damals höchsten Wolkenkratzer des wie aus dem Nichts erwachsenen Stadtteils und aß ein Eis an einem Fenster mit Aussicht. Aber wo ist der Kratzer, das höchste Gebäude Chinas, denn jetzt nur geblieben? Ex-Studentin „Stella“, die übrigens nach drei Jahren mit ihrer Dauerwelle und der fehlenden Brille, vielleicht auch wegen des lackierten Handtäschchens nicht wiederzuerkennen ist, klärt mich auf: Inzwischen steht direkt nebenan ein neuer Wolkenkratzer, der siebzig Meter höher ist. Da fällt „mein“ Wolkenkratzer, der Jin-Mao-Turm, kaum noch auf. Sic transit gloria mundi!
Schließlich – Programmpunkt 2 – finden wir in der Einkaufsstraße Nanjing Lu ein appetitliches Restaurant mit Fensterplatz und famosem Blick auf die Wolkenkratzerlinie von Pudong. Nicht so famos sind andere Aussichten, nämlich die, dass die beiden in Kürze einen Ort gefunden haben werden, an dem sie das an YUST Gelernte vertiefen können – und damit meine ich selbstverständlich nicht nur Deutsch...
Vor der Abreise um 20.20 Uhr muss ich noch mein Gepäck aus dem Hotel holen. Etwaige Komplikationen halte ich diesmal dank eines großzügigen Zeitplans auf Distanz. Dafür holt mich in Form einer kolossalen Kopfschmerzattacke der Schnupfen ein, den ich dem kalten Hotelzimmer zu verdanken habe. Schanghai gilt als südchinesische Stadt und im südchinesischen Subtropengebiet sind Heizungen unüblich.
Die Stadt, die nicht endet
Eine nicht immer ganz glückliche Verbindung, das sind in China seit jeher Hotelzimmertüren und ich. In Xi'an war ich im Winter 2005 drei Stunden lang Sturm klopfender und krakeelender Gefangener meines eigenen Zimmers, weil das Schloss defekt war (bei externem WC!) und ein Jahr zuvor in Longsheng an den Reisterrassen kann der nächtliche Besucher, der meine Klamotten nach Geld durchwühlte, während ich schlafend daneben lag, seine diebischen Absichten in Anbetracht eines Fensters in steiler Wand auch nur durch die Tür verwirklicht haben. Diesmal war die Sache fast noch rätselhafter: Ich komme zurück von der Ausstellungseröffnung „Zoe – Kind am Kabel“, Bilder, mit denen ein Fotokünstler privaten Trennungsschmerz verarbeitet, und bin plötzlich selbst getrennt: von meinem Bett. Die Tür lässt sich zwar öffnen, aber der Sicherheitsriegel, der sich nachweislich nur von innen vor die Tür schieben lässt, verhindert das Eintreten. Ich rufe meinen österreichischen Zimmergenossen Richard, der eigentlich nicht als Früh-zu-Bett-Geher berüchtigt ist durch den Schlitz. Dann eile ich in die Lobby. Dort sitzt Richard mit einigen Deutschlehrer-Kollegen zusammen bei ein paar Bier und scheint den Ernst der Lage gar nicht zu begreifen. Die Rezeption lässt einen Techniker kommen und als Richard, der übrigens an der YUST, meiner Ex-Uni, unterrichtet, dann endlich ins Bett will und vom Gang aus zwei Männern in Arbeitskleidung dabei zusehen darf, wie sie sich bei inzwischen offener Tür an dem Riegel zu schaffen machen, reagiert er verstört. „Hab' ich dir doch erzählt!“, sage ich. Es handelt sich nur noch um die Wiedermontage des Riegels. Danach funktioniert alles wieder reibungslos. Schließlich kann sich Richard vor Lachen kaum noch halten. Wie für alle Rätsel der Menschheitsgeschichte gibt es natürlich auch für dieses eine einfache Erklärung. Nur kennen wir die nicht.
Noch mehr gibt es von diesem Tag zu berichten, der nicht drögen Konferenzdiskursen gewidmet war, sondern als Ausflugstag das Programm auflockern sollte. Dazu begeben wir uns zunächst auf den zwei Stunden langen Weg zum Außencampus der SISU, wo die Chinesen mal wieder Erstaunliches bewerkstelligt haben. Die diversen Unterrichtsgebäude sind architektonisch den diversen Herkunftsländern der Sprachen nachempfunden, die hier gelehrt werden: Eines sieht aus wie eine Moschee, ein gewaltiges englisches Herrenhaus ist zu bestaunen und das Hauptgebäude erinnert von ferne an den Petersdom. Theologie wird hier aber natürlich nicht unterrichtet.

Eine Studentin, die von der für sie zuständigen Lektorin als „rosa Phantom“ bezeichnet wird, beeindruckt an der Seite von drei weiteren studentischen Deutsch-Leuchten durch einen Vortrag im Loriot-Stil, der Vortrag und Parodie eines Vortrags in einem ist. Was auch immer intendiert war – grandios! Dass sie vom Großstadtleben gleichsam abgeschnitten sind, sehen die Studenten als Vorteil: „So gibt es wenig Ablenkung für uns und wir können uns auf das Studium konzentrieren.“
Danach geht es auf den höchsten Berg von Schanghai, eine Erhebung, kaum höher als der Ketelvierth, auf der eine katholische Kirche steht, die schon schlechtere Tage gesehen hat (nämlich während der Kulturrevolution). Schließlich führt die Reiseroute uns noch in die so genannten Wasserdörfer nahe Schanghai; das sind alte chinesische Wohn- und Gewerbehäuser, die an einem Kanal liegen, was als chinesisches Venedig gepriesen wird. Aber der Vergleich mit den Amsterdamer Grachten trifft vielleicht eher zu. Auf dem Weg zurück präge ich im Bus den Spruch von der Stadt, die nicht endet, denn dieser Eindruck entsteht unweigerlich, wenn man stundenlang an Hochhäusern vorbeifährt und einfach nicht ans Ziel kommt. Zum Vergleich: Der Ballungsraum Schanghai hat 15 Mio. Einwohner, ganz Holland 16.
Vergissmeinnicht
Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn mal alles reibungslos geklappt hätte. Als ich gegen 18 Uhr in dem Konferenzhotel der SISU (Shanghai International Studies University) ankomme, fordert man beim Einbuchen an der Rezeption einen Ausweis von mir. Der liegt natürlich in Nanjing! Kurze Ratlosigkeit. Was tun? Ich schlage vor, wieder nach Nanjing zurückzureisen, um das dringend nötige Papier zu holen, weiß allerdings, dass es anderswo auch schon ohne Ausweis ging (allerdings in zumeist weniger vornehmen Absteigen). Zum Glück findet mich die von der Deutsch-Abteilung der SISU zum Empfang der Konferenzteilnehmer abgestellte Studentin Lili, wie sie später, des Deutschen mächtig, mit eben diesen Worten bekennen wird, sehr nett und hilft mir aus der Bredouille, indem sie für mich bürgt. Dann geleitet sie mich zu dem zehn Fußminuten entfernt gelegenen Konferenzsaal an der Universität. Unterwegs revanchiere ich mich für die Hilfe mit ein paar Ratschlägen für ihre Magisterarbeit. In dem Hörsaal, in dem die Deutsch-Lektoren in China, Taiwan und der Mongolei tagen, stehe ich zunächst herum wie Falschgeld, dann weist mir ein studentischer Assistent einen Platz. Und zu essen wird es heute Abend auch noch etwas geben. Die SISU lädt ein. Und wer steht, der Zufall will es so, auf einmal in der Schlange zum Buffet neben mir?
Ein Tag im November
Eigentlich wollte ich mich nach dem Erwerb einer Fahrkarte zur Deutschlektoren-Konferenz in Schanghai von Montag bis Freitag nächster Woche am Eingang zum Xuanwu-See mit Emily bzw. Emilie treffen, um das erste französisch-chinesische Sprach-Gipfeltreffen zu eröffnen. Aber irgendwie muss da eine E-Mail verloren gegangen sein, denn das Treffen findet nicht statt und ich wandere alleine am Seeufer entlang. So bin ich's ja schließlich auch gewohnt. Herrliches Novemberwetter übrigens, ein bisschen diesig, aber sehr angenehme Herbsttemperaturen so um die vierzehn Grad. Als Kind erklärte ich ja den November forsch zu meinem Lieblingsmonat, allerdings hatte das mehr mit dem Klang des Namens zu tun als mit dem Wetter. Hier in Nanjing ist der November bisher allerdings tatsächlich der angenehmste Monat gewesen. Bei Sonnenschein kann ich immer noch mit kurzer Hose und freiem Oberkörper auf dem Balkon sitzen.
Und noch was Schönes: Dank FC-B-Anhängerin Julia (sin-o-meter berichtete am 14.9.) kann ich mich den ganzen Tag auf den heutigen Abend freuen, wo Bayern gegen Cottbus live ausgestrahlt wird. Ich habe mit Julia folgendes Abkommen geschlossen: Wenn sie mir jede Woche eine E-Mail schickt, welches Spiel der Bundesliga samstags im chinesischen Fernsehen übertragen wird, beantworte ich ihr im Gegenzug per E-Mail eine Grammatikfrage. Ist doch fair, oder? Das Ganze endet auch noch hochgradig erfreulich mit 4:1. Sagt da noch jemand was gegen Novembertage?
Kür der Besten
Gestern habe ich erfahren, dass ich zwei Professorinnen zur Nanjinger Fremdsprachenschule (bei uns würde man das wohl humanistisches Gymnasium nennen) begleiten darf, um bei der Auswahl von zwei Kandidaten mitzuwirken, die von der extrem schweren Hochschulaufnahmeprüfung (chinesisches Abitur) befreit werden und im Herbst direkt zu uns kommen dürfen, um Deutsch zu studieren. Zunächst mal werden wir in einen eiskalten Konferenzraum geführt und dort legt man allen Hochschullehrern (auch der Fachbereich Französisch, Japanisch u.a. sind vertreten) erst mal einen diskreten Briefumschlag auf den Tisch. Inhalt: der nicht ganz unbeträchtliche Betrag von 400 Yuan als Aufwandsentschädigung. Ich kann meine nächste Barabhebung also noch etwas verschieben und denke nicht zum ersten Mal, seit ich hier bin, an den alten Bibelspruch: „Wer da hat, dem wird gegeben werden; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.“
Vier Schüler, die an der Schule alle bereits sechs Jahre Deutsch gelernt haben, wurden für das Prüfverfahren ausgewählt. Es gibt eine Männerquote: Da die Mädchen generell besser sind und meistens ihre männlichen Konkurrenten weit hinter sich lassen, sitze ich mit drei Schülern und einer Schülerin in dem kleinen Prüfungsraum, der eigentlich ein Büro ist, und lese ein Diktat vor. Danach beaufsichtige ich noch eine Stunde der schriftlichen Prüfung. Es schließen sich, nach einer kurzen Pause, vier Einzelgespräche, also mündliche Prüfungen, an. Professorin Kong eröffnet den Dialog mit dem Prüfling, in den ich mich dann ebenso wie die zweite Kollegin einschalte. Ein Schüler, der im Rahmen eines Austauschprogramms bereits ein Jahr in Berlin war, will uns unbedingt das (kopierte) Zeugnis der Berliner Schule vorlegen, in der er gelernt hat. Ich stutze bei einigen grammatisch korrekten, aber doch holprigen Formulierungen und über den Satz (ich zitiere aus dem Gedächtnis: „[...] und lies sich gut in den Klassenverband eingliedern.“ Entweder Berlin bekräftigt durch eine Schulsekretärin, die sofort entlassen werden müsste, und drei unterzeichnende Studienräte, die ebenfalls „lassen“ nicht von „lesen“ unterscheiden können, den durch die jüngsten PISA-Ergebnisse genährten lamentablen Ruf der Stadt im Bildungssektor oder, was ich – PISA hin oder her – eher für wahrscheinlich halte: Hier liegt uns eine Fälschung vor. Für das Bildungsland Deutschland hoffe ich, dass letzteres der Fall ist. Dafür spricht immerhin, dass der Schüler mit dem Zeugnis nach der Auswertung beider Prüfungsteile den letzten Platz belegt. Platz eins war im Grunde schon vor dessen Bestätigung qua Prüfung vergeben: an das Mädchen.
Weltliteratur
Heute fuhr ich nach der Sprechstunde mit der Studentin im Bus zurück, die eine fromme Großmutter hat. Weil ich den Bettlern hin und wieder ein paar „Groschen“ in die Büchsen schmeiße, die an Bushaltestellen lauern, kommen wir ins Gespräch darüber, wie man eigentlich wissen kann, was richtig und falsch ist. Dreimal dürft ihr raten, nach welchem interessanten Buch der Weltliteratur sie mich später fragen wird.
Unterwegs nach Purple Mountain - Teil 3
Zwar gilt der Jugendkreis-Klassiker „Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen“ auch in China, doch als ich auf meiner Querfeldein-Wanderung durch menschenleeres (!) Gebiet an einer großen Mauer anlange und – zack – auch schon auf dem Pfeiler sitze, fällt mir ein, dass vor zwei Wochen eine für Müllentsorgung oder -überwachung zuständige Frau oben in der Nähe des Gipfels von einem Weg abriet, den ich einschlagen wollte, weil er in militärisches Sperrgebiet führe, und eingedenk meines halbtägigen Militärgewahrsams an der Grenze zu Russland im August 2005 lasse ich lieber Vorsicht walten und werde prompt durch einen Hinweis auf einem Stahltor bestätigt: MILITARY AREA. ENTRY PROHIBITED. Man muss ja sein Blatt auch nicht überreizen. Also wieder zurück nach oben und dann auf ausgetretenen Touristenpfaden wieder runter. Negative Begleiterscheinung dieser Vorsicht: Ihr habt hier heute nichts Spannendes zu lesen. Und auch nicht Neues. Studenten, die an mir ihr Englisch ausprobieren, sind nicht neu, auch nicht im Fall dieses Architekturstudenten, der mich oben unweit der Seilbahn anspricht und bald nach Südaustralien will, aber als Begriff für Architektur „Mechanical engineering for buildings“ verwendet. Vor Australien übt er daher noch ein bisschen Englisch, z.B. mit deutschen Wanderern.
Auch nicht neu ist Hans. Den Mann, der letzten Sonntag überraschend im GoDi aufgetaucht war, treffe ich kurz vor Sonnenuntergang zufällig unten am Fuße des Berges vor dem „Weißes-Pferd-Park“.
Für die Statistik hier noch die Anzahl der Foto-Termine: vier, und zwar eine Gruppe Jugendlicher, ein kleiner Knirps, der eigentlich gar nicht wollte, aber für seinen Papi musste, und ein hübsches junges Mädchen. Beim vierten Mal, das war schon beim Abstieg, habe ich nicht mehr genau hingeschaut, wer da genau mit mir abgelichtet werden wollte.
Schwiegersöhne haben's leichter
Ja, ich gebe es zu: Die Dinge wiederholen sich, das sin-o-meter bietet nur noch banale Alltagsgeschichten.
Heute klingelt im Seminar zum Thema „Verfassen einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit“ kurz vor Schluss das Mobiltelefon eines Studenten. Normalerweise finde ich das ja nicht so toll, doch rasch stellt sich heraus, dass Professorin Kong am anderen Ende der Leitung spricht. Sie lässt mir ausrichten, dass gleich nach dem Seminar Prof. Hallmeyer, ein Gast aus Mannheim, einen Vortrag zur Gesprächsanalyse (Teilbereich der Textlinguistik) halten wird, zu dem ich mitsamt allen Studenten des Seminars natürlich auch geladen bin. Die Kollegin entschuldigt sich auch gleich: „Habe ganz vergessen dir zu sagen.“ Der Professor ist sehr freundlich, nicht so das Klima in dem Raum, das Fenster nach Norden oder Westen hat, jedenfalls ist die Sonne nicht zu sehen und ich bekomme kalte Füße. Zur Entschädigung bittet Prof. Kong den deutschen Professor, einen Kollegen und mich zum Essen in das feine Restaurant Xin Zazhi. Ich krame immer mal wieder meine angestaubten Brocken aus einem Brinker-Seminar in Hamburg 1990 hervor (Klaus Brinker, angesehener Textlinguist) und der Professor aus Deutschland weiß mit dem Ergebnis einer empirischen Untersuchung zu generationsübergreifenden Gesprächen innerhalb von Familienverbänden zu verblüffen: Dabei, so erklärt er, bildeten sich archaische Muster ab: Die Schwiegertochter habe tendenziell die geringsten Redeanteile. Schwiegersöhne hätten's leichter. Professorin Kong bestätigt: Das könne in der Tat in China auch so sein.
Unverhofftes Wiedersehen
Nanu, wer stellt sich denn da heute im GoDi der internationalen Gemeinde als Neuling vor? Hans, ein mir bekannter Student aus Deutschland und gleich daneben eine deutsche Studentin, die schon auf dem Ausflug zum Qixia-Berg (sin-o-meter berichtete) mit dabei war. Da sind sie also wieder, die U-Boot-Christen, die unvermittelt wie aus dem Nichts mitten im Meer der Möglichkeiten auftauchen. Allerdings bekennt Hans, der Stil sei nicht so ganz sein Ding. Heute predigte ein Kameruner (ich vermute das, weil er ein Englisch mit französischem Einschlag spricht, das aber wiederum so gut ist, dass es eben nur Kamerun sein kann) mit dem für Schwarzafrikaner typischen Temperament und einer mitunter auch etwas gewollten Exegese. Dann muss er die Predigt spontan abkürzen, weil es schon halb zwölf ist (GoDi-Beginn: 9.30Uhr). Noch eine Deutsche gesellt sich nach dem GoDi zu der kleinen Gruppe Deutscher: Simone, Gast aus einer kleineren Stadt zwischen Schanghai und Nanjing.
Unterwegs nach Purple Mountain - Teil 2
Diesmal nehme ich die Seilbahn. Man gönnt sich ja sonst nichts. Kostet auch nur umgerechnet sieben Mark, dafür kann man in Deutschland nicht mal 'ne halbe Stunde – so lange dauert der Seilzug auf die 448 Meter – Zug fahren. Diesmal ist das Wetter kälter und doch viel besser als vor einer Woche. Denn endlich sehe ich die Wolkenkratzerlinie von Nanjing. Im Mittagsdunst sieht sie entschieden ein bisschen postkartenreif aus, auch wenn man mit New York natürlich nicht mithalten kann. Im Vordergrund erstreckt sich die kilometerlange Seilbahn, die endlose Folge lindgrün überdachter Zweisitzer, über die grün-bunten Hänge des Purpur-Bergs. Kalt ist es geworden. Immerhin scheint nach zwei Tagen Dauerregen wieder die Sonne. Ich wandere über den Grat – auch hier breite, gepflasterte Wege – hinab ins Tal auf der Südseite der Hügelkette. Dort erwartet mich der Linggu-Park mit einer riesenhaften Pagode. Dass einem ein Wanderweg einfach abgeschnitten wird, indem man an einem Kontrollpunkt umgerechnet 16 Mark Eintritt zahlen muss, kommt mir reichlich ungelegen. Ich dringe in das 16-Mark-Areal, das ich ja nur als Wanderer, nicht als Tourist durchqueren will, also lieber über die so genannte grüne Grenze ein, jenseits der ausgetretenen Touristenpfade. Dabei bleibt meine schöne, graue Posthose an dem Stacheldraht hängen, der den zwei Meter hohen Zaun krönt. Naja, vom Rad fallen ist schlimmer. Selbstverständlich würdige ich die Pagode kaum eines Blickes, ich bin ja nicht als Tourist hier, sondern als Wanderer auf der Durchreise, gelange dann aber immerhin noch zur Sun-Yat-Sen-Gedenkstätte (unweit des bereits besuchten Mausoleums, siehe 13.9.). Schließlich passiere ich einen Amüsierpark, komme an einem seismologischen Institut vorbei, dessen Hunde mich verbellen, und lande zusammen mit einem Trupp Jugendlicher, denen ich es einfach gleichtue, in Bus Nr. 2, der mich zurück bringt in die Stadtmitte. Nächste Woche dann Teil 3, wenn das Wetter so bleibt.
Aus dem Rennen
Pustekuchen. Ich lese eher versehentlich meine Nachrichten unter dem alten Dienstleister web.de und an die Adresse schickt Herr Li (sinngemäß): Wir haben unsere Auswahl schon gemacht. Wer etwas dagegen hat, bitte umgehend mitteilen, da wir bis heute 18 Uhr die Liste an die Veranstalter in Guangzhou schicken müssen. Natürlich ist diese Frist längst Vergangenheit (denn ich lese die Nachricht ja einen Tag später) und natürlich haben Herr Li und seine Kollegen zwei (von insgesamt acht) ganz andere Studenten ausgewählt, als ich es getan hätte. Für mich zählt ja nur Grammatik. Ich repliziere leicht gereizt: „Eure Kandidaten werden kaum Chancen haben. Die waren bei mir schon am ersten Abend aus dem Rennen.“ Ich ergänze (sinngemäß): Naja, nun ist's geschehen. Machen wir das Beste draus. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten und ist eine sehr ausführliche Begründung für die Entscheidung, an der sich ja nun nichts mehr ändern lässt.
Da fragt man sich natürlich: War meine Meinung wirklich gefragt?
Wieder debattieren
Heute wieder Debattier-Probe. Ich muss aber korrigieren. Einer E-Mail zufolge soll überraschend bereits morgen feststehen, wen wir entsenden. Ich rufe also den zuständigen Lehrer, Herrn Li (genau, der, der am 9. Oktober wieder ins Bett durfte) an und der sagt mir: „Nein, heute ist nur die Vorauswahl. Entscheidende Auswahl, wie gesagt, Sonntag.“ Ich kann also beruhigt weiterkorrigieren.
Der Tintenkiller der Zukunft
Zwischenprüfungswoche. Das bedeutet stöhnende Studenten an allen Fronten und Korrekturen (an insgesamt 77 Prüfungen) bis zwei Uhr nachts. Die herausragende Beobachtung innerhalb dieser Woche ist wohl die Studentin, die mit folgender innovativer Technik ihre Fehler verschwinden lässt: Der Tintenkiller der Zukunft, der hier entwickelt wurde, ist Tesafilm, den man auf das auszutilgende Wort drückt und dann wieder abreißt mit dem Ergebnis: Papier dünner, Fehler futsch. Verblüffend!
Ausgerechnet der Absolventenjahrgang scheitert an einer vermeintlich leichten Übung. Der mit Fehlern gespickte Ausschnitt aus einer fiktiven Abschlussarbeit hat bei den meisten Studenten nach der Zwischenprüfung mehr Fehler als vorher. Ziel der Klausur war aber eigentlich, alle Fehler auszumerzen, und nicht, neue hinzuzufügen, indem man richtige Sätze vermurkst: 80 Prozent durchgefallen. Da müssen wir wohl noch mal ran.
Afrikaner unter sich
Heute bin ich wieder im englischsprachigen GoDi der St.-Paul's-Kirche. Ich treffe zwei Liberianer, einen Mann, eine Frau, die in Nanjing studieren. Beide sind in dicke, grüne Armeemäntel gehüllt. Immerhin haben wir jetzt tagsüber mitunter nur noch 15 bis 19 Grad. Das sind für Westafrikaner extrem niedrige Temperaturen. Ich gebe mich sofort als Exil-Guineer zu erkennen – und siehe da, der Student der Technischen Universität war zur selben Zeit in der Dschungelregion von Guinea wie ich (1996): er als Flüchtling in einem südguineischen Flüchtlingslager (wegen des Bürgerkriegs in Liberia, siehe auch „Blood Diamond“), ich auf Missionstour mit dem Jesus-Film. Wir fachsimpeln über Afrika, dass die Chinesen neben uns aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Schließlich mache ich mich auf den Weg nach Hause. Na, noch nicht ganz, denn unten vor dem Eingang steht Emilie (französische Schreibweise) mit einer Freundin und kommt noch mal auf die geplanten études françaises (sin-o-meter berichtete) zu sprechen. Mal sehn...
Unterwegs nach Purple Mountain
Heute ist der Zijin- oder Purpur-Berg dran. Er befindet sich westlich vom Xuanwu-See, den ich auf meinem Weg passiere, und ist Teil eines riesigen Naherholungsgebietes, in dem sich auch das Sun-Yat-Sen-Mausoleum befindet, das ich Mitte September (sin-o-meter berichtete) als Teil der Spezialveranstaltung für ausländische Lehrkräfte bereits besichtigen durfte. Das ganze Unterfangen ist im Grunde eine Miniatur-Ausgabe meiner Huangshan-Tour: Im Verhältnis zur Größe des Areals sind genauso viele Leute auf den steinernen Treppen unterwegs. Wie dort gibt es eine parallele Seilbahn für Faule und Fußkranke und einen tiefer gelegenen Antennengipfel, wie dort stellt sich mit zunehmender Dienstgipfelhöhe auch wieder der berüchtigte Clooney-Effekt (sin-o-meter berichtete) ein. In einem Rast-Pavillon finde ich mich unvermittelt in einer kichernden vierköpfigen Mädchengruppe wieder; die trauen sich noch nicht. Wenig später aber darf ich für eine gemischte Gruppe posieren (das peinliche Fragen übernehmen die Jungs). Oben auf dem höchsten Punkt, dem Purpur-Gipfel, treffe ich sie wieder. Eines der Mädchen hat das Kunststück fertig gebracht, ihr Kuscheltier, einen ca. einen Meter langen hellblauen Plüsch-Delfin, bis hierher auf dem Arm zu tragen. Das ist wahre Liebe! Immerhin sieht der Delfin mit seinen Knopfaugen ungefähr so viel von der Tiefe, die wir überragen, wie ich, denn heute ist ganz Nanjing in einen dichten Dunstschleier gehüllt.

Ich raste eine Zeit lang auf einer Treppe vor einem Pavillon. Unten auf dem Platz, den ich überblicke, amüsiert sich ein Trupp Ausflügler mit den üblichen Spielchen (sin-o-meter berichtete). Hinter mir kichert es schon wieder: Offenbar hat sich ein Mädel den Spaß gemacht, sich mit meinem Rücken als Hintergrund vor dem Pavillon ablichten zu lassen. Dann kommt ein Junge, wohl aus derselben Gruppe, die Treppe emporgestiegen, will ein Foto mit mir. Und kaum dass ich eingewilligt habe, husch, sitzt die Kichererbse auch schon neben mir. Clooney von vorne ist eben doch besser.
Ich sitze noch ein paar Minuten allein. Ehe dann aber die nächsten Kandidaten von unten kommen, geht es bergab mit mir. Doch auch unten im Tal, wo ich in einem Park, in dem viele Hunde, die gute Aussichten haben nie in einer Suppenschüssel zu landen, Auslauf haben, auf einem Felsen meine letzte Pause einlege, bin ich nicht lange allein: Ein ehemaliger Angestellter oder Beamter des öffentlichen Dienstes, Stadtverwaltung oder so, über sechzig und schon pensioniert, wie er mir erzählt, probiert an mir sein nicht ganz unangestrengtes Englisch aus. Jeden Satz kaut er einmal für sich vor, ehe er ihn an mich richtet. Hat was von Professor Hastig aus der Sesamstraße. Denn es entstehen minutenlange Gesprächspausen, in denen ich hilflos in die Luft gucke. Europäer können so was eigentlich nicht, solche Gespräche führen. Ich erfahre immerhin, warum der Berg heißt, wie er heißt, weil nämlich die Felsen oben eine braunrote Färbung haben. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Da der rüstige Rentner nicht die geringsten Anstalten macht, von meiner Seite zu weichen, blase ich am Ende zum Aufbruch. Er ist mir behilflich und begleitet mich zu einer Bushaltestelle, an der Bus Nr. 20 halten wird, der mich zum Nordrand der Uni bringt. Da er offenbar nie ohne eine alte Armeekarte das Haus verlässt, verdanke ich dem freundlichen Herrn schließlich auch noch die wertvolle Information, auf welcher Höhe ich mich auf dem Höhepunkt des heutigen Tages befunden habe, nämlich auf exakt 448 Metern. Huangshan in Miniatur eben.
Kostenloses Blog bei Beeplog.de
Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.
|
|
|