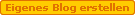| |
Chiang Khong
Erst ohne Visum auf dem Weg nach Laos und nun ohne Pass rüber nach Thailand. Man kann nicht behaupten, dass ich mir untreu würde. Aber an der Grenze gibt es Komplikationen: Ich müsse, falls ich wirklich mit dem Boot hinüber nach Thailand wolle, ein neues Visum für Laos beantragen. Denn man würde mir das Visum von gestern entstempeln. Ich argumentiere, was das denn für'n Unsinn sei, ich wolle doch nur mal eben für zwei Stunden rüber. "Das ist aber ganz normal", mischt sich eine blonde Besserwisser-Deutsche ein, die gerade aus Thailand rübergeschippert gekommen ist. "Wenn man das Land verlässt, braucht man eben anschließend ein neues Visum!" - "Wir sind hier doch nicht in Deutschland", versetze ich. "Da ist solche Bürokratie vielleicht normal!" Als hätte er meine Worte vernommen, zeigt sich der Zollbeamte nun sehr konziliant und behält meinen Pass ein. Ich kriege ihn in zwei Stunden wieder, meint er. Ich also, wieder 10.000 präsidiale Kip für die Bootsfahrt, rüber nach Thailand und um eventuellen Nachfragen seitens der Grenzer dort gleich aus dem Weg zu gehen, wate ich das Ufer auf einer sandigen Nebenstrecke empor, frage dort einen Mann, der in einem Verschlag döst, ob hier ein Weg sei. Er antwortet: "Ja, Abkürzung!" Und da mich nun auch sonst niemand mehr kontrolliert und ja auch in dem Touristentrubel an der An- und Ablegestelle keiner darauf geachtet hat, ob ich von diesseits oder jenseits der Grenze bin, bin ich in Null Komma nichts auf dem Weg ins Zentrum von Chiang Khong/Thailand. Es trennen nur ein paar Meter Wasser die beiden Ortschaften, beide mit 15.000 bzw. 12.000 Einwohnern etwa gleich groß, aber der Unterschied ist wie Tag und Nacht: Drüben gibt es nichts, hier alles. Als Symbol für westlichen Lebensstandard ragt das Logo eines "Seven-Eleven"-Ablegers mit vielen Produkten im amerikanischen Stil von der Fassade in die Straßenschlucht hinein. Jenseits der Hauptstraße finden sich kleine eingezäunte Grundstücke mit kleinen Postkästen vor weiß schimmernden Flachbauten - auch eine US-Kopie. Hinter einem der Zäune ist ein weißer Alt-Hippie mit langen Zotteln gerade mit seiner Wäsche beschäftigt. Ist vom letzten Trip wohl nicht mehr zurückgekommen. Kommt öfters vor. Ich verlasse die Ortschaft und lande auf einem Hügel mit kleiner Anbetungsstätte für Buddha und den Ortsheiligen, der auf Fotos daneben hängt, alles schon bisschen verwachsen. Aber Hasso passt auf und verbellt mich.
Ich flaniere auf der Uferpromenade zurück, viel natürlicher, beschaulicher und nicht so auf Massentourismus getrimmt wie in Jinghong. Einen echt thailändischen Buddha-Tempel mit Flussblick muss ich noch in Augenschein nehmen. Auffällig ist, im Vergleich zu chinesischen Tempeln (Foto aus Ganlanba), die viel üppigere und filigranere Goldverzierung der Giebelseiten. Auch merkwürdig: Hier auf der thailändischen Seite stehen keine Palmen.

Ich sitze zwischen Tempel und Bootsanleger auf einer Bank mit Blick auf den Mekong und das laotische Ufer, da kommt ein Moped. Der Mann bittet mich zur Seite zu treten und klettert via Bank auf den Baum hinter mir. Dort hängt sein kleiner gefiederter Freund im Käfig. Soll auch mal schöne, grüne Blätter sehen. Aber jetzt geht es heim! Das gilt auch für mich. Schließlich habe ich meine zwei Stunden schon auf drei ausgedehnt und so nehme ich das nächste Boot über den Fluss. Noch einmal 10.000 unlesbare Kip. Ich bin der einzige Passagier. Ich denke: Ob die wohl auf die Uhr geschaut haben? Aber der Grenzer, der meinen Pass einbehalten hat, wundert sich, dass ich schon so früh zurück bin.
Im B.A.T.-Gasthaus ist schon wieder ein französisches Pärchen abgestiegen. Der Indochina-Effekt! Sie fragen mich nach dem "Loneley Planet", in dem ich zum x-ten Mal blättere. Ich bin unentschlossen: weiter ins legendäre Luang Prabang, von dem alles schwärmt oder gen Norden zurück, Richtung China? Ich entscheide mich für letzteres. 25.000 Heiner-Bremer-Konterfei-Kips will der Taximann. Bei solchen Preisen kip(p)t bei mir die Stimmung ganz schnell und so stehe ich eine halbe Stunde an der Ladefläche herum. Schließlich schließt sich ein Reiseleiter aus Luang Prabang an, der gerade eine Tour abgeschlossen hat und sehr gut Englisch spricht. "10.000 Kip o.k.!", signalisieren die Kleinstransportunternehmer mir. Und schon gibt das Tuc-Tuc Gas!
An der Busstation gibt es um diese Zeit leider nur noch einen Bus nach Luang Prabang. Aber ich habe mich schon zu sehr festgelegt, erwerbe für 50.000 kommunistische Kip eine handgeschriebene Fahrkarte für Luang Namtha im Norden und suche mir, nachdem der Bus mit dem Reiseleiter aus Luang Prabang und sehr, sehr vielen Bleichgesichtern abgefahren ist, eine Absteige in der Nähe, damit ich morgen Tuc-Tuc-frei bin. Ich stoße nach ein paar Hundert Metern auf das Feng-Ping-Hotel - ja, auch hier gibt es Chinesen. Das ist für mich sehr erfreulich: Ich kann in Yuan bezahlen und erspare mir Probleme mit den kuriosen Kip. Dafür ist die Dusche fast kalt. Ich esse im Hinterhof, wo sich beim Essen zwei Fraktionen um zwei Fernseher formiert haben: Laoten gucken hinten ein laotisches, Chinesen vorne ein chinesisches Programm. In der Mitte sitze ich, aber ich gehe gleich wieder auf die Stube und habe dort mein drittes Programm: Der Fernseher hat die US-Variante von "Premiere": HBO. Und da laufen "Roter Drache", gefolgt von "Pelham 123", gefolgt von "Das Bourne-Ultimatum". Hier hat Laos China dann doch mal was voraus!
Grenzerfahrungen
Nach einem Ruhe- und Besinnungstag in Mengla bin ich, ermutigt durch den vertrauenerweckenden Kioskmann, nun also auf dem Weg nach Laos und je näher ich der Grenze komme, desto nervöser werde ich: Werden die mich wirklich einfach so einreisen lassen? Werde ich an der Grenze wirklich ein Visum bekommen? Wird es wirklich möglich sein, über Laos bis nach Thailand vorzustoßen? Und wie soll ich in Laos eigentlich zurechtkommen - ohne Reiseführer, ohne Sprachkenntnisse und ohne... Ahnung?
An der Grenze läuft alles überraschend glatt: Zwar sind 300 Yuan Visumsgebühren nicht so wenig, aber bei der Abfertigung geht alles ganz flott. Ein älterer Herr aus Thailand mit Frau und ein Japaner sind meine Kampfgenossen an den Schaltern. Sogar das geforderte Passfoto kann ich durch einen glücklichen Zufall auftreiben. In meiner Computertasche unten befinden sich noch ein paar alte CFI-Visitenkarten mit Foto, die ich dereinst für Yanji bekam. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Ich grapsche durch das Schalterfenster nach der Schere, die da herumliegt, der Beamte nickt.
Nach einer Mittagspause im Grenzort Boten geht es weiter: Der erste Eindruck von Laos: Die Dächer sind nicht so spitzgiebelig und es gibt noch etwas mehr Regenwald. Letzteres relativiert sich aber rasch, als wir näher ins Land eindringen. Auch hier also, nach dem Muster des großen kommunistischen Bruderlandes im Norden, Monokulturen statt Parashoreas. Der eigentliche Clou an diesem Land ist, dass es hier keine Städte gibt. Zweihundert Kilometer fahren wir über eine der Hauptverbindungsstraßen durchs Land, aber die größte Ortschaft, durch die wir kommen, Vieng Phouk, ist auch nur eine Anhäufung von Bretterbuden und wirkt nicht größer als Wiemersdorf. Von hier aus kann man Ökotourismus betreiben, die neue Geldquelle im Land und eine Hoffnung für den Urwald. Dass das Land im Vergleich zu China wie entleert wirkt, ist kein Wunder: Laos hat nur fünfeinhalb Millionen Einwohner und die Hauptstadt, Vientiane, gilt als die entspannteste von ganz Asien. Sie hat ungefähr so viele Einwohner wie Lübeck. Außerdem ist Laos grandios unterentwickelt. Es erinnert vielfach an ein zentralafrikanisches Land: keine eigene Industrie, keine eigenen Produkte, keine Supermärkte, nur lauter so kleine Klitschen, in denen alles, was bunt ist, aus Thailand oder China importiert wurde. Am späten Nachmittag stranden wir außerhalb von Houay Xai an einer Busstation, die noch fünf Kilometer von der Innenstadt entfernt ist. Ein Tuc-Tuc (so nennt man hier die Sammeltaxis, bei denen die Passagiere auf der Ladefläche transportiert werden - schön luftig!) soll uns für sagenhafte 10.000 Kip (so heißt die Währung hier) an den Mekong bringen. Der Busfahrer reißt mir 100 Yuan aus der Hand und wechselt das in einen unübersichtlichen Betrag, ich glaube ungefähr 120.000 Kip. Auf allen Scheinen befindet sich neben diesen tulpenförmigen Schriftzeichen und einer verwirrenden laotischen Zehn, die anmutet wie eine Neun, das Konterfei des Präsidenten, der aussieht wie die Indochina-Variante von Heiner Bremer: weißhaarig und leicht korpulent. Dasselbe Bild steht übrigens ab und zu als Reklametafel in der Landschaft herum. Im Tuc-Tuc macht es Gluck-gluck: Mit auf der Ladefläche befinden sich ein französisches Pärchen und drei Hühner in einem blauen Sack, der jede Legehennenbatterie als Paradies erscheinen lässt. Die Hühner machen Gluck-gluck. Aber sicher nicht mehr lange.
Am Mekong, der hier die Grenze zu Thailand bildet, hat sich eine lebendige Touristenkolonie gebildet. Gefühlt ist jeder Zweite, der einem über den Weg läuft, ein Tourist aus dem Westen. Unschlüssig, wie es weitergehen soll, begleite ich den Japaner zu den Abfertigungsschaltern vom Zoll, die sich direkt unten am Flussufer befinden. Die Fähre ist ein Achter mit Dach und Motor. Der Japaner will gleich übersetzen nach Thailand. Ich lasse mir da lieber noch etwas Zeit und wünsche gute Reise. Oben an der Uferstraße stehe ich plötzlich vor dem "B.A.T. Guesthouse" und frage ein französisches Pärchen nach der Qualität der Unterkunft. Wissen sie nicht, sie essen hier nur. Betrieben wird der Laden von zwei kräftigen Damen mittleren bis gehobenen Alters, die ihre Gäste so gönnerhaft behandeln, als wären sie ihre minderjährigen Enkel. Ich ziehe schließlich für 60.000 Kip ein und erhalte ein rustikales Doppelzimmer mit Bad draußen im Flur. Unten im Restaurant stehe ich einige Reiseführer zu Laos und Thailand. Das hilft mir natürlich weiter.
Schließlich treffe ich den Australier Ryan, einen pensionierten Lehrer auf Wanderschaft. Er ist gerade aus der Gegenrichtung, also aus Thailand, gekommen. Wir gehen in der Dämmerung etwas oberhalb des Mekong spazieren und bestellen schließlich zwei Portionen Reis mit Ei in einem sehr schön oberhalb des Flusses gelegenen Freiluftrestaurant, in dem so ziemlich jeder Tourist zu dinieren scheint, der jetzt gerade in Houay Xai auf der Durchreise ist. Die Ladung Reis mit Ei kostet so viel, wie einmal Teil der Ladung eines Tuc-Tuc zu sein.
Zwischen Himmel und Erde

Das ist nun unzweifelhaft der Höhepunkt meiner Reise: Ich befinde mich zwischen Himmel und Erde. Ich wandle auf einer endlos scheinenden Reihe wackliger Brücken durch den Regenwald. Und dann gebe ich auch noch sechs Mark für Fotos aus, die man heimlich von mir gemacht hat. Wie konnte es so weit kommen?

Wieder hat mich ein Bus am Wegesrand abgesetzt. Ebenso wie die Angehörigen der Touristengruppe, die hier neben dem Parkplatz herumlungert, bekomme ich eine Rettungsweste übergestreift und besteige ein Motorboot, das mich flussaufwärts mitten in den Himmelsbaum-Park bringt. Ich habe vorher vergeblich nach der Kasse Ausschau gehalten. Entweder man hält mich für einen Bestandteil der Reisegruppe oder die Überfahrt gehört zum Service. Nachdem das Boot angelegt hat, gibt es nun auch endlich die schon vermisste Eintrittskarte (60 Yuan). Auf dem Prince-Philip-Pfad (der englische Gemahl der britischen Königin hat in seiner Eigenschaft als WWF-Schutzpatron diesen Ort besucht und ein paar schützenswerte Bäume entdeckt) wandere ich nun bereits zum dritten Mal durch den Tropenwald. Die selbstgefällige Art, in der die Volksrepublik sich auf Schildern und Info-Tafeln als Wunder was besorgt um den Erhalt dieses seltenen Biotops inszeniert und die eigenen Schutzinitiativen rühmt, geht mir allmählich auf den Geist. Auf einer der Tafeln liest man etwa, dass es nur noch in drei Regionen auf der Welt echten Regenwald gebe: am Amazonas, in Zentralafrika und in Zentralasien, darunter zwei Regionen in China: auf Hainan und hier in Xishuangbanna. Die Wahrheit ist, dass in ein paar Alibi-Ecken ein paar Hektar Wald stehen gelassen wurden, ein Touristenpark hineingebaut wurde, der kräftig Yuan hereinspült, und ansonsten - man sieht es ja, wenn man im Bus in dieser Gegend unterwegs ist - der meiste Urwald Plantagen mit Monokulturen weichen musste. Immerhin lerne ich, dass einige der Bäume hier siebzig bis achtzig Meter hoch werden können. Die Gattung dieser extrem hoch wachsenden Bäume heißt Parashorea. Und diese Riesen hat man nun ganz geschickt für den Tourismus nutzbar gemacht, indem man zwischen ihnen einen Hängebrückenweg errichtet hat. Man wandelt also zehn, zwanzig, wenn nicht mehr Meter über dem Erdboden zwischen Urwaldgiganten umher. Dafür sind allerdings noch mal umgerechnet zwanzig Mark extra fällig. Ich gerate in einen solchen Höhenrausch, dass ich beim Abstieg ganz gegen meine Gewohnheit gleich drei von den zahlreichen Fotos kaufe, die ohne mein Wissen von mir gemacht wurden und die man sich nach dem Abstieg auf Computerbildschirmen anschauen und unter denen man seine Favoriten auswählen kann. Immerhin sind zehn Yuan (zwei Mark) pro Stück noch ganz erschwinglich.

Und dann habe ich es wieder mal geschafft: Ich stehe vor dem Bootsanleger und erfahre: Heute fährt kein Boot mehr zurück. Es ist auch schon halb sechs. Angeblich soll da noch ein Bus kommen, aber an dem Häuschen steht keiner und nach fünfzehn Minuten gebe ich auf und entschließe mich zu Fuß zu gehen. Ich folge dem Flusslauf. So kann ich den Ausgangspunkt der Urwaldexpedition eigentlich nicht verfehlen. Dort könnten noch Busse vorbeikommen.
Diesmal lässt mich der Herr des Universums ganz schön lange zappeln: Wenige Meter vor dem Touristenzentrum, von wo aus das Boot heute Morgen abgelegt hat und das doch so drei, vier Kilometer entfernt ist, holt mich ein Bus ein. Ich bekomme aber nur noch einen Hocker, weil alle Plätze besetzt sind.
Ich habe das 25-Yuan-Hotel verlassen und ziehe in ein 80-Yuan-Hotel, das nicht nur eine verwendbare Dusche, sondern auch einen Internetzugang hat. Die Installation dauert zwar bis zehn Uhr abends, weil der Computerjunge vorher nicht konnte und er auch ganz schön Mühe hat, meinem Computer den Zugang zu erklären, aber dann kann ich endlich ein paar sin-o-meter-Einträge nachholen!
Mengla
Ich habe mich entschieden, mich mal so langsam Richtung laotische Grenze vorzutasten. Etwa hundert Kilometer südlich, auf der neuen Schnellstraße vorbei an den wenigen verbliebenen Regenwald-Hängen, liegt Mengla. Ich stoße nach dem Aussteigen zunächst auf einen rührigen Kioskverkäufer, der ein mehrsprachiges Schild im Fenster stehen hat, auf dem steht: "Dieser Mann ist ehrlich. Man kann ihm vertrauen!", sogar in Deutsch und ohne Rechtschreibfehler! Trotzdem frage ich mich, wie vertrauenswürdig jemand ist, der diesen Satz so nötig hat, dass er ihn in so viele Sprachen hat übersetzen lassen. Er hat es besonders auf Währungstausch abgesehen und zeigt mir ein Portmonee mit Euro, US-Dollar und laotischen Kip. Ich weiß indes noch nicht mal, ob ich überhaupt nach Laos komme - ohne Visum. Doch der Kioskkönig macht mir Mut: Das Visum könne man doch dort an der Grenze kaufen. Ich bin weiterhin unschlüssig - das Privileg des allein Reisenden - und kaufe dem agilen Verkäufer erst mal ein paar Mandarinen ab.
Danach stoße ich auf ein sagenhaft billiges und sagenhaft schlechtes Hotel. Für umgerechnet fünf Mark kann man zwar nicht viel verlagen, nicht mal ein Handtuch, aber als der Abfluss im Waschbecken (kein warmes Wasser) in einem Moment nachlassender Aufmerksamkeit mein komplettes Stück Seife schluckt (ohne Wasserfluss, einfach so ab durchs Loch!), bin ich doch irgendwie bedient.
Den Rest des Tages verbringe ich mit einem Rundgang, Im tiefer gelegenen Teil der Stadt ist, wie an vielen anderen Orten auch, eine komplett neue Trabantenstadt aus dem Boden gewachsen. Noch weiter unten herrscht Trubel auf einem großen Markt.
Im Manting-Park
Leider ist das Touri-Büro geschlossen. Das bringt mich etwas in Schwierigkeiten, denn die freundlichen jungen Damen hatten mir eine Tour bis nach Thailand vorgeschlagen. Ich habe aber die Karte verloren, auf der sie mir den Ort markiert haben, wo man ein Visum für Laos bekommen kann. Ich will jedoch nicht noch einen Tag in Jinghong verlieren. Ich lese etwas am Mekong und gehe dann unentschlossen in den Manting-Park, den traditionsreichsten Park in der Region, in den man hintenrum über den Tempelbereich ohne Eintritt reinkommt, wie ich bei meinem ersten Besuch vor ein paar Tagen festgestellt habe. Unterwegs komme ich an einer Hahnenkampf-Arena vorbei. Überall stehen Hähne in Holzkäfigen herum, und schauen krähend mit den Köpfen raus. In der überdachten Hauptarena, umstanden von Leuten, die wahrscheinlich Wetten abgeschlossen haben, geht es richtig zur Sache: King Cock hat Red Rooster soeben förmlich aus dem Ring gefegt. Da fliegen die Federn! Vorne in der Übungsarena dagegen geht es harmonischer zu. Da umarmen sich gerade Crazy Chicken und sein Sparringspartner Dumb Throat. Die Hähne umschlingen sich mit den Hälsen. Es erinnert sehr an Boxer, wenn einer klammert. Ein Gockel hackt dem andern kein Auge aus!
Abends fliege ich aus dem Park, weil es eine gesondertes Eintrittskarte für eine ethno-kulturelle Veranstaltung mit Tanz, Kostümen und Trommeln gibt, wie ich sie mittlerweile schon mehrfach gesehen habe. Am Eingang stehen schöne Frauen in traditionellen Trachten Spalier, während Touristen hereinströmen und jede einzeln fotografieren. Vor der Zhou-Enlai-Gedächtnisstatue (der berühmte Ministerpräsident nahm hier einst an einem Wasserspritzfest teil) haben sich derweil die Musiker und Tänzer postiert. Da ich nicht mal eine Karte für tagsüber habe, finde ich es nur gerecht, dass ich Manting-Park nun den Abendgästen überlasse.
Jingzhen
In Jingzhen nahe Mengzhe gibt es eine achtgiebelige Pagode ("Octagonal Pagoda") von 1701, die als Touristenattraktion ausgewiesen ist. Der Bus Richtung Menghai setzt mich am Ortsausgang von Jingzhen an einer Einmündung ab und ich muss erst mal zwanzig Yuan bezahlen. Ein Kassierer fängt mich auf der Sandpiste ab. Dann geht es eine Treppe hoch und ich stehe vor einem dieser typischen Buddha-Tempel. Ein paar Hühner und ein paar Mönche in den typischen orangefarbenen Gewändern turnen auch hier herum. Die Pagode steht neben einem heiligen Baum, von dem nur noch die Wirtsbäume, die ihn überwuchert haben, leben. Aber jetzt mal ehrlich: An der Pagode ist nichts drin und nichts dran, außer eben diesen acht Giebeln. Ich wandere dorfauswärts an einem Fischteich und einem abgeerneten Zuckerrohrfeld vorbei und komme an einen größeren Teich, dahinter das Jingzhen-Gewerbegebiet. Ich wandere die Straße mit dem großen Teich hinab Richtung Hauptstraße, bin mir aber plötzlich nicht mehr sicher, ob das die richtige Straße ist, weil links doch längst der Weg zur Pagode hätte auftauchen müssen. Also wandere ich sicherheitshalber so zurück, wie ich gekommen bin, pese zwecks Abkürzung über die am Boden liegenden raschelnden Blätter des Zuckerrohrfeldes und finde schließlich zur Oktagonalpagode zurück. Rasch wird klar, dass ich zuvor doch auf der richtigen Straße gewesen bin; ich hätte nur noch etwa 500 Meter durchhalten müssen. Zur Strafe für diese Blödheit verordne ich mir einen Gewaltmarsch zurück nach Mengzhe, aber das zieht sich dann doch ganz schön. Als ich den Ort nach einer Stunde erreicht habe, bin ich nicht mehr sicher, wo die Busstation war und lasse mich von einer Motor-Rikscha-Tante überreden einzusteigen. Es wird auch schon dunkel und wenn ich heute noch nach Jinghong zurück will, wird es Zeit. Der letzte Bus nach Jinghong fährt um 19.30 Uhr ab. Als ich der Tante zehn Yuan gebe, meint sie plötzlich, stimmt so, und ich finde das natürlich gar nicht witzig, sondern werde ein bisschen laut. Denn vereinbart waren fünf. Da rückt sie dann mit einem Grinsen das Wechselgeld doch noch raus. Man kann's ja mal versuchen... Mit dem gelben Minibus geht es wieder zurück nach Menghai. Ich blicke nervös zur Uhr, als unterwegs am Straßenrand noch ein paar Verstreute aufgesammelt werden. In Menghai, drei Minuten vor halb acht, meint der Fahrer dann, es gebe keinen Bus mehr, er werde mal was organisieren, ich solle nur schön warten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Jinghong-Bus noch nicht abgefahren ist, jedenfalls will ich selbst nachschauen. "Komme gleich!" versetze ich, komme aber nicht zurück, denn ich bekomme noch eine reguläre Fahrkarte.
Nannuo Shan
Ich bin gestern Abend in Menghai eingetroffen und habe dort ein ziemlich miserables Hotelzimmer bezogen: Eine Ecke ist ungleichmäßig grün angepinselt worden. Ein Fragment. Den Maler hat in Anbetracht der hässlichen Farbe entweder der Schlag getroffen oder er ist von der Leiter geschubst worden, als er für seine Arbeit bezahlt werden wollte; jedenfalls ist es bei dieser halb grün gestrichenen Ecke geblieben, der Rest ist weiß. Das Bad taugt auch nichts, aber immerhin verfüge ich hier im obersten Stockwerk über eine Glasfront mit Blick auf die Stadt. Und dann noch das: Kurz vor oder nach Mitternacht muss ich runter in das Stockwerk unter mir. Da ist eine Schulklasse oder Kinder-Sportmannschaft völlig außer Rand und Band! Die schreien da rum und knallen mit Türen. "Noise like in a football stadium!", schimpfe ich, weil ich "Fußballstadion" auf Chinesisch nicht sagen kann, auf Englisch. Man entschuldigt sich wenig schuldbewusst. Es wird dann doch etwas ruhiger.
Heute nun bin ich auf dem Weg zu meinem eigentlichen Ziel: dem Nannuo-Berg (Nannuo Shan), berühmt für seine Teepflanzungen. An der Stelle, wo der Bus mich rausschmeißt, bin ich erst mal ratlos und esse in einem Straßenrestaurant eine Nudelsuppe. Dann frage ich meinen Sitznachbarn und da auch im "Lonely Planet" von 1988 von einer Brücke die Rede ist, die man überqueren müsse, folge ich also den übereinstimmenden Hinweisen und komme hinter der Brücke über die Schnellstraße, einem schmalen Wanderpfad folgend, auch bald an den ersten Teeplantagen vorbei. Schöner Talblick! Aber plötzlich bin ich in einer Sackgasse, vor mir Teepflanzen ohne Ende, über mir ein paar Bananenstauden, aber kein Weg mehr! Ich erinnere mich an eine Weggabelung, die ich vorhin passiert habe. Die habe ich rechts liegen gelassen, weil es dort in den Busch ging. Doch das war wohl der richtige Weg. Es wird immer dichter und dunkler um mich, die Bäume höher und gewaltiger: Ich bin wieder im Tropenwald, diesmal ohne Park. Aber in der Ferne röhrt schon die Motorsäge, als wollte sie sagen: Diese paar Hektar kriegen wir auch noch klein!
Es ist schon ziemlich spät, als ich oben auf dem Berg auf eine breitere Sandpiste und ein Bergdorf stoße, in dem mich überall Hunde anbellen. Auf der anderen Seite des Grats bietet sich mir ein monumentales grünes Gebirgs-Panorama, durch das ich mich belohnt fühle für den Mut trotz vorgerückter Stunde diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Doch jetzt ist es wirklich schon ziemlich spät. Nach sieben dürfte ich unten an der Hauptstraße kaum noch einen Bus erwischen. Ich bin unentschlossen: Soll ich der breiteren Straße folgen, die zweifellos ins Tal führt? Das raten mir jedenfalls alle Einheimischen, die ich nach dem Weg zurück frage. Doch die haben ihre Mopeds und kennen sich aus. Ich dagegen strande in dem Dorf, das gar nicht mal so klein ist, immer wieder in Sackgassen und Hofeinfahrten und als ich schließlich dem breiten Weg eine Viertelstunde gefolgt bin, macht er einen so gewaltigen Schlenker um ein Massiv herum, dass ich einfach nicht mehr daran glaube, dass dies der direkteste Weg nach unten ist, und frustriert umdrehe. Unterwegs blicken mich Einheimische erstaunt an und fragen, wo ich denn hin wolle, nein, der Weg sei aber falsch... Quark, denke ich, die halten mich für einen überforderten Touristen, der sich nicht auskennt, können ja nicht wissen, dass ich auf diesem Weg auch hinaufgekommen bin! Nun aber hurtig...
Am Anfang ist noch alles wiederzuerkennen, aber plötzlich bin ich von Teeplantagen umgeben, die es hier doch vorhin beim Aufstieg noch nicht gab! Und prompt endet der Weg. Zurück. Wart mal, habe ich an diesem Holzhäuschen im Teefeld nicht vorhin gerastet? Nein, da war ein Baum. Diese Hütten sehen ja auch alle gleich aus! Und die Zeit drängt. Es ist schon nach sechs! Und schon wieder eine Sackgasse! Was ist denn das bloß? Himmel hilf! Ich denke an die Nacht von Monterrey: Damals fand ich auf einem Berg den Rückweg nicht vor Sonnenuntergang und musste dort oben übernachten – ein Horror! Nu’ mal ruhig Blut!, sage ich mir und bitte Jesus mal kurz um eine klare Wegweisung ("Weise mir, Herr, deinen Weg..."). Und als ich jetzt zum Ausgangspunkt des falschen Pfads zurückkomme, höre ich eine Landmaschine, die vorhin noch da stand, wo ich falsch abgebogen bin. Im Nu finde ich meine Orientierung wieder und es geht ohne weiteren Irrtum abwärts. Phasenweise rase ich die Hänge förmlich hinab, die äußeren und inneren Fliehkräfte sind enorm! Schließlich stoße ich auf den Teewanderweg. Dreißig Minuten später bin ich an der Hauptstraße. Nach zehn Minuten kommt auch schon ein Bus. Als ich gegen halb acht in Menghai ankomme, ist es schon dunkel. Ich schaffe es trotzdem noch, in einem dieser kleinen gelben Minitransporter nach Mengzhe weiterzureisen. Direkt neben dem Busbahnhof liegt ein nettes, gut eingerichtetes Gasthaus mit einer freundlichen Bedienung,
Grenzort Daluo
Der Tag beginnt mit einem blinden Bonzen, der mich mit seiner schwarzen Limousine fast anfährt, als er aus einer Ausfahrt kommt. Ich reagiere auf derlei mittlerweile reflexhaft mit Fußtritten gegen die Motorhaube. Irritiert schleicht der Bonze weiter, bleibt im Schritttempo wenige Meter vor mir. Ich denke: Ist der etwa von der Partei und macht auf Mr. Wichtig? Oder ist das nur die Autofahrer-Variante gegen Gesichtsverlust? Am Ende werde ich ihn doch noch los. Mein Ziel ist ein kleiner Hügel oberhalb von Daluo. Schweißgebadet erreiche ich den Grat zwischen den beiden Hügeln und treffe hier oben sogar auf eine kleine Hütte, vor der eine ältere Frau ihr Feld behackt. Ich finde weiter vorne ein Pausenhäuschen aus Holz, das so flach ist, dass man darin nur liegen kann, und blicke hinab auf das Flusstal mit Daluo und Daluo-Hafen (so ähnlich wie Kleinkummerfeld und Kleinkummerfeld-Bahnhof) vor den fernen Bergriesen, die im Dunst bläulich-grün schimmern. Und wenn ich den Blick weiter nach rechts schweifen lasse, so kommt dort bereits die burmesische Stadt jenseits der Grenze in Sicht. Ein paar langweilige Hochhäuser, weniger blaue Dächer, aber etwas größer ist die Stadt. Von Tropenwald ist hier auf den Hängen übrigens keine Spur. Der ganze Berg ist bestanden von derselben Baumart, eine einzige große Plantage.
Als ich nach einem Fußmarsch unter sengender Sonne über den hinteren Bergabhang schließlich wieder in Daluo eingetroffen bin, entschließe ich mich, die verbleibende Stunde bis zur Abfahrt nach Menghai mit einem Ausflug an die Grenze zu nutzen. Ich spreche einen der Mopedfahrer an, die am Straßenrand herumlungern, aber der versteht wohl kein Chinesisch. Sein geschäftstüchtiger Kollege springt sofort ein, spricht davon, dass man das in einer halben Stunde erledigt haben könne, Kostenpunkt hin und zurück: 20 Yuan (vier Mark). Und schon sitze ich hinten bei ihm auf dem Kraftrad. Angesichts des Ofenrohrs, durch das der andere Moped-Heini fragwürdige Substanzen inhaliert, ist mein Fahrer wohl auch die bessere Wahl gewesen. Der Wind weht mir um die Ohren, es geht über die Brücke, an Maisfeldern vorbei, die Gebäude werden immer verlassener. Schließlich halten wir vor einem türlosen Portal, das in einen lichten Wald führt und durch das Leute mit Säcken und Taschen spazieren: der kleine Grenzverkehr. Für mich als Ausländer aber ausgeschlossen, belehrt mich mein Chauffeur, obwohl ein paar andere Fahrer, die hier herumlungern, mich weiter in den Wald locken möchten. Auch hinter den Torpfosten ist immer noch China. Hier wohnen in schäbigen Katen auch noch ein paar Leute. Ich gehe im letzten öffentlichen WC (eher ein DC, dry closet) vor der Grenze mal kurz auf Klo und schaue durch die Ritzen: Dort steht ein stolzes Zollhaus und leuchtet weiß im gleißenden Licht. Mein Fahrer ist mir nachgeeilt, er wird langsam nervös. Mit Warten lässt sich ja kein Geld verdienen. Wir sausen zurück. In der Ferne sehe ich den Berg, auf dem ich vor ein paar Stunden noch saß.
Mengjinglai

Das Dai-Dorf Mengjinglai, 3 Kilometer von Daluo entfernt, ist berühmt für seine 101 goldenen Pagoden, die 101 besonderen Mönchen gewidmet sind. Ansonsten ähnelt die Wanderung durch das Dorf doch sehr dem, was ich schon in dem Gegenwartsfreilichtmuseum von Ganlanba zu sehen bekam. Deshalb gehe ich durch den kleinen Wald am Ortsausgang weiter, überquere den Daluo-Fluss auf einer alten Hängebrücke im Indiana-Jones-Stil und werde angezogen von einem einsam gelegenen, vom Busch überwucherten Holzhütte. Das kleine Gehöft erweist sich als verlassenes Gasthaus. Nur noch die zusammengestellten Stühle, jede Menge Müll und Scherben erinnern daran, dass hier früher der Bär getanzt hat. Ich gehe weiter und komme wieder an einen Fluss: Ich bin also auf einer Insel, die zwei Flussarme umgeben. Ich setze mich auf einen Ast, der über den Fluss hinausragt; schließlich gehe ich zurück zur Brücke. Dort schwitze ich so lange in der Nachmittagssonne, bis ich mich entschließe kurz ins Wasser unterhalb der Brücke zu springen. Leider ist das Ufer etwas sumpfig und prompt trete ich auch noch meine Unterhose in den Dreck, die ich nach dem Badeausflug erst mal auswaschen muss. Ich setze mich wieder auf die Brücke und lasse das Kleidungsstück auf dem Geländer trocknen. Vier jugendliche Mönche in orangenen Gewändern kommen über die Brücke und nähern sich dem verlassenen Gasthaus. Keine Ahnung, was die da machen. Die Hose ist zwar noch nicht trocken, aber ich kann ja nicht ewig hier bleiben. Ich wandere noch etwas durch die Gassen von Mengjinglai und falls die Sprache der Einheimischen so ähnlich funktioniert wie die der Indianer, bin ich für sie jetzt wahrscheinlich Der-seine-Unterhose-spazieren-führt. In der Dorfmitte gibt es wieder so einen Ein-Baum-bildet-einen-Wald-Baum. Heilig, heilig! Am Flussufer gibt es einen Festplatz. Und durch den Buddha-Tempel rauscht auch hier der Wind. Ich gehe die drei Kilometer bis Daluo zu Fuß zurück. Aber - Ordnung muss sein - vorher habe ich mir im öffentlichen WC die getrocknete Unterhose wieder angezogen.
Auf der Suche nach Uwe Johnson
Wirklich, ich schwör’s: Ich wollte heute mal ein teureres Hotel nehmen, ich hatte meine Sachen auch schon dort auf der Theke liegen, aber es will einfach nicht klappen. Denn plötzlich fällt mir ein, dass ich mein Uwe-Johnson-Buch (aus meiner eigenen Bibliothek ausgeliehen) und einige andere Sachen im Bus habe liegen lassen. Dem Taxifahrer, einer von denen, die am Busbahnhof die Reisenden abfangen und die sie gar nicht rasch genug in ihre fahrbaren Untersätze verfrachten können, bedeute ich also: Alles zurück auf Null! Wir sausen flugs zurück zum Busbahnhof von Daluo, wo mich die eben mit ihrem Transportangebot abgeblitzten Zweiradtaxifahrer freudig wieder begrüßen. Doch ich komme zu spät: Der Busfahrer ist schon entschwunden. Was tun? Gemeinsam überlegen die Bediensteten vom Busbahnhof, mein Taxifahrer und ich. Dann fällt der Fahrkartenverkäuferin ein, wo der Fahrer untergebracht sein dürfte, da fahren wir nun hin. Prompt finde ich auch den Bus, verriegelt, und der Fahrer ist nicht da. Also bleibe ich hier. Der Fahrer wird schon irgendwann auftauchen. Die Unterkunft kostet genau wie in Jinghong achtzig Yuan, ist aber etwas vornehmer. Abends klopft es dann bei mir an der Tür: Uwe Johnson ist wieder da! Übrigens ein sterbenslangweiliges Buch! Nun könne ich also ruhig und zufrieden sein, aber gegen Mitternacht klopft es wieder, allerdings an des Nachbars Tür. Dazu ruft eine Stimme ohne Unterlass: "Hello! Hello!" Nach einer halben Stunde muss man doch selbst mit einstelligem IQ mal kapieren, denke ich entnervt, dass da jemand nicht öffnen will oder nicht da ist. Schließlich springe ich in meine Hose und beschwere mich. Ein junger Mann steht da verdattert im Gang und ein junges Mädchen neben ihm. Sie ziehen ab und jetzt ist Ruhe! Ich werde noch zum Neurotiker mit diesen nächtlichen Ruhestörungen immer!
Ganlanba
Einen Elefanten bekomme ich heute dann doch noch zu sehen, einen für Touristenfotos abgestellten mit Fußfessel und Sänfte auf dem Buckel, auch schon leicht verhaltensauffällig. Er steht am Eingang zum Garten der Dai-Ethnie, in den ich eher zufällig geraten bin. Ich war eigentlich auf dem Weg nach Manmaisangkang, aber der Bus kommt auf der Strecke, die dem Flusslauf des Mekong folgt, nur bis Ganlanba, wo ich keinen Anschluss habe. In Ganlanba zieht mich ein palmengesäumter Fahrdamm an, der zwei Seen trennt. Ich wandere den See entlang, dann folge ich einem Weg am Rand eines Bananenfeldes und komme mitten im Garten der Dai-Ethnie heraus und auf dem Weg lag auch gar kein Kassenhäuschen, obwohl ich sicher bin, dass dieses Freilichtmuseum mit lebendem Anschauungsmaterial Eintritt kostet. Angesichts der Pleite mit den Elefanten gestern habe ich auch gar keine Skrupel hier ohne Eintritt hereingekommen zu sein. Neben dem bedauernswerten Dressur-Elefanten sehe ich nun auch das nachgestellte Wasserspritzfest, das die Dai normalerweise nur einmal im Jahr abhalten, nämlich am 14. April. Von einem großen Springbrunnen aus, in dem die Damen und auch ein paar Herren in traditionellen Trachten knöcheltief im Wasser stehen, wird also wild gespritzt. Wer von den Touristen trocken bleiben will, geht besser mal auf Abstand.

In einer Arena nebenan werden wieder folkloristische Tänze aufgeführt. Die Musik scheppert mir zu laut, ich gehe weiter und durchquere gleich mehrfach das Dorf, das geprägt ist von diesen blassbraunen Dai-Häusern mit grauen, verschachelten Schindeldächern. Auch hier wird überall gebaut oder Holz gesägt. Wer den Touristen genug Geld aus der Tasche gezogen hat, ersetzt die alte Kate durch eine neue und die alten Schindeln durch knallblaue Keramikdachpfannen. Das sieht dann natürlich nicht mehr so touristentauglich tradítionell aus. Am Ende des Dorfes stoße ich wieder auf den Mekong. Ich wandere einen Hang hinab. Dort unten am sandige Ufer legt gerade ein kleines Motorboot an. Ein älterer Mann hat sich auf dem anderen Ufer, hinter dem im blauen Dunst die grünen Bergriesen im blaugrauen Dunst schimmern, ein tolles Panorama, mit Tropenfrüchten (Papaya usw.) eingedeckt und schleppt nun ein Joch mit zwei Körben den Weg hinauf. Den Manting-Tempel muss ich noch sehen: Durch den Tempel (die Gold-Buddhas sitzen hier immer gern vor gemalten Bäumen, Bäume scheinen im Hinayana-Buddhismus eine besondere Rolle zu spielen) rauscht der Wind und lässt die Klingglöckchen klingen. Nebenan zieht offenbar gerade eine Gruppe Westler zu einer fernöstlichen Therapie ins Tempelhäuschen. Man sieht auch immer mal ein paar Mönche in diesen orangenen Gewändern herumwandeln. Als ich zu lange zuschaue, was die Westler mit den Rucksäcken da machen, komplimentiert man mich nach draußen. Ich gehe wieder zurück zum See, übrigens umgeleitetes Mekong-Wasser, und gelange in ein Baugebiet. Hier entstehen neue Hotels. Der nette junge Mann am Wächterhäuschen lässt mich aber durch. Über einen zweiten Damm, der den See noch einmal teilt und auf dem Bananen wachsen, gelange ich wieder auf die Seeseite, von der aus meine heutige Expedition begann, wandere noch einmal über den Fahrdamm mit den Palmen, der mir so gut gefällt, und sitze alsbald wieder im Bus nach Jinghong.
Abends ziehe ich im Dicos, der chinesischen Ausgabe von Kentucky Fried Chicken, die verstörten Blicke sämtlicher im Gasthaus sitzender Chinesen auf mich. Einen Moment lang glauben alle, ich bin irr. Ich stehe gerade an der Kasse, als eine Mama mit Kleinkind hereinkommt und letzteres sofort laut zu kreischen anfängt. Reflexhaft kreische ich zurück. Ja, scheint ja hier normal zu sein so'n bisschen Rumgekreische! Trotzdem ist die Kreischerei nun dann doch erst mal vorbei.
Im Tal der wilden Elefanten
Mit Schildern, die dazu auffordern, das Trompeten den Elefanten zu überlassen, die hier leben und vom Autohupen gestört werden könnten, und anderen, auf denen ein Elefant das Anschnallen vormacht, wird der Tourist auf dem Weg ins Tal der wilden Elefanten ("Wild Elephant Ravine") schon mal wild gemacht. Ich bin trotzdem skeptisch und frage mich die ganze Zeit: Werde ich am Ende dieses Tages wirklich, wie versprochen, Elefanten in freier Wildbahn gesehen haben? Wie wollen die denn sicherstellen, dass ausgerechnet in dem Moment, in dem Touristen sich die Ehre geben, Elefanten am dazu auserkorenen Wasserlauf auftauchen? Entweder die Elefanten sind nicht wild oder gefangen oder die ganze Sache geht schief. Im Wildelefantenmuseum, zu dem ein imposanter Hochweg führt, den man sich am besten vorstellt wie den Aussichtsturm am Ketelvierth, nur dass die Aussichtsplattform ein Gang von 2,7 Kilometer Länge ist, wird mir erklärt, dass man das Wasserloch mit dem Zusatz von schmackhaftem Salz zur Attraktion für die Dickhäuter gemacht hat. In der autonomen Region Xishuangbanna, deren Hauptstadt Jinghong ist, sollen sich noch etwa 250 Elefanten tummeln, 75 davon in diesem Park. Neben dem Museum noch ein Schild: "Bitte zur Seite treten, wenn hier Elefanten auftauchen." In der Tat säumen dicke Haufen von Exkrementen den Weg, der einem flachen Bach folgt. Auf einer Brücke überquere ich den Wasserlauf. Ich war schon einmal auf der anderen Seite, weil ich jenseits der Furt wieder diese Haufen und Tretspuren gesehen habe, denen will ich doch mal nachgehen. Aber schon fängt mich ein Parkarbeiter ab. Und von hinten hat sich bereits ein uniformierter Parkwächter an meine Fersen geheftet und schickt mich zurück auf den rechten Weg. Ich wollte ja nur mal gucken... Die Brücke führt weiter durch den Dschungel, als ich den kleinen Bach schon hinter mir gelassen habe: noch so eine kilometerlange Balustrade, schmaler und aus Eisen, durch den Dschungel, an deren Ende man dann die Elefanten von oben besichtigen kann, ohne sie an ihrem Lieblingsplanschbecken zu stören. So der Plan. Und dann das, was man eigentlich voraussehen musste: Das Tal der wilden Elefanten ist eine von ca. einer Billion Baustellen in China. Generatoren machen einen Höllenkrach. Selbst der dickfelligste Dickhäuter kann kein so dickes Fell haben, dass er sich davon nicht in die Flucht treiben lassen würde. Hat einem natürlich kein Mensch erzählt.
Ich bin stocksauer und gehe weiter zur Seilbahnendstation. Dort setze ich mich in den überdachten Wartebereich und esse meine Mandarinen. Was raschelt das denn da hinter mir? Ich drehe mich um und denke im ersten Moment an einen Gorilla, aber der schwarze Affe, der sich auf den Bäumen hergeschwungen hat, ist viel kleiner und hat einen weißen George-Washington-Backenbart. Der temperamentvolle Besucher wird rasch zur Attraktion der chinesischen Touristen, die sich zum Affen machen lassen und zum kollektiven Fototermin um den lustigen Gesellen scharen. George Washington liefert noch ein paar akrobatische Einlagen, ehe ein blasierter Soldat ihn mit Steinen bewirft, weil er ihm wohl zu frech ist. Der Affe sucht aber nicht das Weite, sondern nur die Höhe. Als sich keiner mehr für ihn interessiert, hangelt er sich dann doch davon.
Ich gehe zurück und schaue mich im Vogelpark um. Ara und Kakadu trauen mir nicht so recht über den Weg. Die Scharen von Wellensittichen, die frei herumfliegen dürfen, nehmen Alfred-Hitchcock-Dimensionen an. Da ich ein sturer Hund bin, gehe ich noch mal zum Wasserloch. Uniformierte Wichtigtuer wollen mich gleich zweimal zurückschicken, da gleich Feierabend ist. Ich zeige auf mein Eintrittsbillett: 8 bis 18 Uhr steht da in arabischen Ziffern, also noch eine Stunde! Nun wollen wir mal locker bleiben, wenn da hinten schon die Generatoren laufen! Und die laufen - war ja klar - auch noch bei meinem zweiten Besuch. Leider hat die Seilbahn den Betrieb eingestellt, ich bin dennoch pünktlich am Ausgang. Eigentlich will ich mein Geld zurückverlangen, ich bin gerade so in Moserstimmung, aber die Schalter sind alle verwaist. Ich gehe zur Bushaltestelle, kein Bus in Sicht. Da kann ich noch mal kurz auf Klo. Als ich wieder da bin, ist der Bus gerade weg. Das jedenfalls sagt mir einer der Uniformierten am Eingang. "Gerade abgefahren!" Ich solle es mal unten an der Autobahn probieren. Da kommen vielleicht noch andere Busse vorbei. Prima, denke ich, erst keine Elefanten, dann auch noch den Bus verpasst. Während ich die Straße entlangwandere und so richtig in Moserstimmung bin, mahnt mich mein inneres Ich, jetzt mal kein so undankbarer Miesepeter zu sein, sondern Gott ein Loblied anzustimmen, weil er mich ja bisher noch aus jeder misslichen Lage befreit hat. Keine fünf Minuten selbst komponierter Loblieder später hupt mich ein Bus nach Jinghong an und lässt mich einsteigen. Gott ist doch der Beste! Nur ein umgekippter Sandlaster hält uns noch kurz auf.
Abends gibt es auf dem großen Platz, unter dem sich ein Riesen-Einkaufsparadies befindet, auf Großleinwand einen chinesischen Progagandafilm mit bösen Briten, die das Heiligtum einer Schar wackerer Mönche erobern und am Ende in die Luft gesprengt werden.
Im Regenwald
Gestern habe ich unweit der Uferpromenade eine Kirche entdeckt und mich auch gleich nach den GoDi-Zeiten erkundigt. Um halb neun finde ich mich also in einer Gemeinde im Stil der "Assembly of God" ein. Die Mao-Zeit macht sich mal wieder bemerkbar: Senioren bestimmen das Erscheinungsbild. Ich verstehe leider nicht viel von der Predigt (es geht irgendwie um Ziele im Leben) und blicke irritiert um mich, wenn der Prediger zwischenzeitlich immer mal wieder zu freundlichen Gesten gegenüber den Sitznachbarn auffordert. Die jungen Damen vor, hinter und neben mir (ja, nee, eine ältere Dame sitzt da auch noch) nehmen mir freundlicherweise die Kontaktarbeit ab. Auf dem Nachhauseweg winkt mir eine von ihnen noch eifrig aus dem Wagen zu.
Ich mache mich dann gegen ein Uhr von der Busstation aus auf den Weg in den "Jungfrauenwald-Park". Der Bus nach Mengyang setzt mich am Ausgang ab. 50 Yuan Eintritt zahle ich und bin erst mal wenig angetan von dem etwas betagten Areal. Ein kleiner unterirdischer Buddha-Tempel, vom Regen angegammelt, und ein Pfauengehege sind die erste Station. Neben dem Park rauschen Autos auf einer schnellen Piste vorbei, da kommt wenig Regenwald-Stimmung auf. Interessanter ist dann schon die Hängebrücke, über die ich ein am Hang errichtetes kleines Aini-Dorf erreiche (d.i. offenbar eine Hani-Untergruppe - mehr zu Chinas ethnischen Minderheiten liest man hier). Wer hier mal gelebt hat (falls dies nicht nur ein Nachbau ist), wurde von Fortuna geküsst, denn die Einheimischen haben die Lizenz zum Gelddrucken. Statt bei der Feldarbeit raue Hände zu bekommen, können sie hier den lieben, langen Tag in ihren traditionellen schwarz-bunten Trachten ihrem Hobby nachgehen, Folklore-Tänze aufzuführen, und Touristen für 20 Yuan pro Person (was sonst vielleicht ein Tageslohn ist) mit Schnappschüssen beglücken oder mit einer Ein-Personen-Seilbahn über das Tal schubsen (Bungeejumping für Anfänger sozusagen), was ich mir selbstredend nicht nehmen lasse. Touristen dürfen ferner eine traditionelle Aini-Hochzeit nachspielen (passenderweise bedeutet "ai ni" in Mandarin-Chinesisch "liebe dich"), bei der die Frau erst mal unterm Schleier verborgen bleibt, und sich dabei fotografieren lassen. Man bekommt dazu eine hübsche Aini-Maid an die Hand und muss laut vernehmlich den Satz sprechen: "Ich will heiraten!" Ich also nix wie weg. Ich lasse mich schleunigst ins Tal schubsen.
Die nächste Station ist ein Wasserfall, danach kommt eine offene Festhalle mit Bühne, auf der werden zu lauter Musik wiederum folkloristische Choreografien dargeboten. Eigentlich geht es hier um ein Wasser-ins-Gesicht-Spritzritual fü Frauen, ein alter Brauch offenbar, aber das Bassin ist leer. Wohl zu kalt heute. Ich schaue mir gemeinsam mit zirka hundert Chinesen also die Show da vorne an und lasse mir Schweineschaschlik und einen Papaya-Nektar servieren. Auch eine Lizenz zum Gelddrucken: Alles ist dreimal so teuer wie normal.
Richtig interessant wird es, als ich die ersten Rhesusaffen erblicke, die hier in vollendeter Symbiose mit den Menschen leben und nicht nur auf den Bäumen, sondern auch auf den Bambusstegen mit den neugierigen Touristen herumturnen und manchmal sogar im dahinter gelegenen Freiluftrestaurant hospitieren, was den Ober aber rasend eifersüchtig macht. Jedenfalls haben die Rhesusaffen keinerlei Interesse daran, wieder im Wald unterzutauchen. Hier gibt es ja viel mehr zu essen: Touristen, die offenbar der Affe laust, werfen ihnen Karotten zu. Einer der Affen kommt mir auf dem Steg so nah, dass er mir ins Gesicht spucken könnte, aber zum Glück sind Affen keine Lamas. Als ich ihm ein Gespräch aufzwinge, spitzt er den Mund und dreht mit den Ohren. Ich denke, gleich dreht auch der Rest von ihm durch und der springt mich an, und beende das einseitige Gespräch lieber rasch. Am Anfang eines Parcours durch wirklichen Tropenwald, wie er im Buche steht, kann man ein Foto mit einem merkwürdigen zahmen Bären machen lassen, der sich in Zeitlupe nach einem Stück Honigmelone ausstreckt, das ihm der Besitzer aber partout nicht geben will, und auch sonst aufgrund der schwarzen Ringe um seine Augen ziemlich verschlafen wirkt. Das Tier ist kleiner als ein Koalabär, ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Nie zuvor gesehen.
Dicht und üppig wächst hier der Wald. Der Pfad folgt einem Bach, der sich durch den Wald schlängelt. Die Bäume sind so hoch wie Wolkenkratzer. Kaum Licht dringt an einigen Stellen noch ein. Lianen baumeln von den Baumriesen herab. Die Affen hatten wir schon, zwei Janes bin ich unterwegs auch schon begegnet. Es fehlt eigentlich nur noch Tarzan! Auch der Bambussteg, der durchs Dickicht führt, wirkt so authentisch, dass man sich der Illusion hingeben kann, wirklich im Urwald zu sein. Einer der Riesen wurde vom Schicksal entwurzelt und versperrt den Weg. Da einige der Bäume an den Wurzeln üppig miteinander verwachsen sind und die Wurzeln aussehen wie ein Wald, nennt man sie hier auch Einwaldbäume. Ein kahler Stumpf sieht aus wie ein am Boden schnuppernder Elefantenrüssel und wurde folglich auch so betitelt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein Schild weist am entferntesten Punkt des Rundweges auf das Ende der Ausbaustrecke hin. Ich springe rasch übers Geländer des kleinen Verweilpavillons. Will doch wenigstens einmal kurz richtig im Busch sein. Aber der Weg wird rasch ziemlich unwegsam.
Erst auf dem Rückweg habe ich mich zum Erinnerungsfoto mit dem Schlafbären entschlossen, wie immer zu spät: Die Jungs bauen gerade ab. Also hier heute kein Bild. Dafür sehe ich am Ausgang des Parks, wo schon ein Omnibus wartet, andere Bären: Schwarzbären, die hier von Zeit zu Zeit in einem Spontan-Zirkus auftreten, gemeinsam mit den Bremer Stadtmusikanten auf Chinesisch: Pferd, Hund, Wolf, Löwe und einem Sibirischen Tiger, dessen Vorderpranken den Umfang von Dirk Bachs Gesicht haben. Alle diese bedauernswerten Kreaturen liegen oder stehen in Käfigen, die so klein sind, dass sie sich darin nicht einmal umdrehen können. Der Tiger hat den Kampf aufgegeben und liegt schlaff herum. Der Schwarzbär ist bereits schwer verhaltensgestört und schüttelt ununterbrochen den Kopf, als wollte er sagen: "Nee,nee, nee!" Auch dem Löwen geht es hundsmiserabel, er scharrt manisch mit der Vordertatze auf dem Käfigboden herum.
Im Bus bekomme ich nur einen Stehplatz, aber eine freundliche junge Dame kann das nicht mit ansehen und bietet mir ihren Sitzplatz an, was ich natürlich annehme. Man muss ja zu Damen immer höflich sein. Die Frauen der Minderheiten sind in der Regel schöner als die Han-Chinesinnen, sie haben keine Schlitzaugen und sind natürlich viel dunkler, exotischer sowieso. Naja, vielleicht profitieren sie auch einfach vom Wohlstand, den das neue China über sie gebracht hat. Immerhin haben zwei meiner Studentinnen auch bereits Schönheitsoperationen an sich vornehmen lassen. Aber pst! - nicht weitersagen!
Am Ufer des Mekong lasse ich den Tag ausklingen. Es wird dunkel und die beiden Brücken erstrahlen ebenso wie die Touri-Fallen vor und hinter mir in bunten Lichtern. So endet ein fast perfekter Tag. Der Makel: Leider hat der FC B gestern zwei Punkte gegen Wolfsburg verspielt.
Am Mekong

Das Wunderbare an China ist ja, dass man in ferne Länder reisen kann, ohne das Land zu verlassen. Denn es gibt so entlegene Provinzen wie Yunnan. Und so befinde ich mich seit gestern am Mekong. Myanmar und Laos sind auch nicht mehr fern. Ich bin gestern Abend erst nach acht Uhr (statt 19.15) Uhr gelandet und danach so lange hilflos auf dem Parkplatz vor dem Mini-Flughafen von Jinghong herumgeirrt, dass mich der Charterbus, der eine Mutter-mit-Kind-Urlaubsreisegruppe ins Luxushotel verfrachten soll, deren Reiseleiter ich nach einem Omnibus gefragt habe, einfach mitnimmt - von den kleinen Reisenden beim Einstieg mit Jubel und viel Hello! empfangen. Der Reiseleiter ist, wie er den Damen mitteilt, Lahu. Das ist eine der hier vertretenen ethnischen Minderheiten. Ich frage beim Aussteigen noch mal nach, aber nein, ich muss nichts bezahlen. Auch diesmal habe ich wieder eine billige Unterkunft gefunden, auf Nachfrage sogar mit ordentlichem Sitzklo. Ich logiere im obersten Stockwerk, direkt unter dem spitzgiebeligen Dach mit hübschem goldenen Türmchen obendrauf. So viel Stolz muss sein! 8 Euro die Nacht. Die Mutter-Kind-Gruppe zahlt in dem Prachtpalast nebenan vermutlich das Fünffache.
Den heutigen Tag habe ich bei sonnigen 25 Grad der Erkundung der Stadt gewidmet. Die typisch vergoldeten Kuppeln und die spitz zulaufenden Giebel, die man aus Burma und Thailand kennt, bestimmen das Bild. Beisielhaft ist ein einfacher Tempel, an dem ich vorbeikomme, aber der Eingang ist verschlossen. Anscheinend wird hier noch renoviert.

Selbst den Betonungeheuern, die auch hier beharrlich in den Himmel wachsen, hat man noch solche Giebel aufgesetzt, damit das Stadtbild erhalten bleibt. Die Beschriftungen sind dreisprachig: Neben Chinesisch und Englisch findet man die absonderlich rund geschwungene Schrift der Nachbarstaaten. Ich wandere eine Promenade oberhalb des Flusses entlang, die die beiden Flussquerungen, eine etwas betagtere mit vielen Pfeilern und eine hochmoderne mit Stahlseilen, verbindet. Am Hafen ist alles wie ausgestorben. Das Jinghong River Voyage, architektonisch einem Schiff mit sechs Decks nachempfunden, ist verrammelt und leer. Es gebe momentan keine Passagiere, teilt mir die junge Dame mit, die einsam in der Schiffsverkehr-Abfertigungshalle hinter dem Tresen sitzt. Man sieht aber auch sonst keine Schiffe, auch keine Frachter und Schoner, auf dem Fluss. Ich vermute, das liegt am niedrigen Pegel. Man sieht deutlich an den vielen Steinen am viel zu breiten Ufer: Der Mekong hat hier schon mal deutlich mehr Platz beansprucht. Extrem freundlich und zuvorkommend sind die beiden Damen im Fremdenverkehrsinfohaus. Sie haben heute vermutlich noch nicht viele Touristen betreut. Hochsaison scheint hier nicht gerade zu sein.
Zwei Mal
War da nicht noch gestern ein Schild mit der Aufschrift Green House? Irgendeinen Grund muss es doch geben, dass ich das Restaurant nicht mehr finde. Ich renne also wirklich an dem Lokal vorbei, in dem meine Kollegen selbstredend schon sitzen und warten - auf den wichtigsten Gast des Tages. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden ein und denselben Ort nicht wiederzuerkennen - das schafft auch nicht jeder!
Mal zwei
Koinzidenz nennt man das: Die Studenten des Jahrgangs 07, die so artig bei der Deutschlektorenkonferenz mitgeholfen haben, haben noch was gut bei mir. Ich lade alle (auf Kosten des deutschen Steuerzahlers, versteht sich) zum Essen ein. Ausgesucht haben sie (sie, das sind in diesem Fall die figurbewussten weiblichen Studierenden, die 80 Prozent der Klasse ausmachen) sich ausgerechnet ein vegetarisches Restaurant, das ich morgen gleich noch einmal aufsuchen werde: Dann feiere ich - auf eigene Kosten - meinen Verbleib in Nanjing! Ab ins Taxi. Yijie hat Xiaoqi an der Strippe und lotst die Taxifahrerin ans Ziel. Und ich passe genau auf, damit ich morgen den Ort auch wiederfinde.
Meine zehn peinlichsten Momente
Auf der Bestenliste der zehn peinlichsten Momente meines Lebens hat dieser sicherlich einen Platz verdient: Ich habe heute einen Nachholklausurtermin. Sechs Studenten des Jahrgangs 07 stehen um elf Uhr schon im Gang. Mir wurde zugetragen, jeder Raum sei am heutigen unterrichtsfreien Tag verwendbar. In dem, den ich mir nehme, sitzt aber schon wer hinter einem Stapel mit Heften und Lehrmaterial. Ich denke, das ist wohl ein Student, der lernen will, und bitte ihn den Raum zu verlassen. Tut er aber nicht. Ich denke: So ein renitenter Flegel! und werde rabiat. Meine Studenten versuchen derweil kleinlaut Alternativen vorzuschlagen. Ich herrsche also den vermeintlichen Studenten an und erst nach und nach wird mir klar: Das ist nicht nur kein Student, es ist zudem noch jemand, der Teil eines Instituts ist, das auf diesen Raum viel eher Zugriffsrechte hat als ich. Und am Eingang zum Saal hing auch ein Blatt mit einem Hinweis auf diesen Umstand. Chen Dong alias Eva, die auch mit von der Partie ist, weist schnell auf einen Nachbarraum hin, in den ich aber mal ganz schnell ausweiche. Nach der Klausur entschuldige ich mich bei dem Kollegen.
Nicht rangehen!
Andere Leute wachen mit einem Brummschädel auf, ich bekomme den erst, nachdem ich auf meiner Mobiltelefonanzeige gesehen habe, dass Danyu aus Chicago versucht hat, mich um 8.24 Uhr hiesiger Zeit anzurufen. Viel schlimmer sind aber zwei Anrufe und eine SMS in Abwesenheit von "Nicht rangehen!" Weihnachten hatte sich "Nicht rangehen!" auch schon (vergeblich) gemeldet. Wie es zu diesem seltsamen Adressbucheintrag kam und wer sich hinter "Nicht rangehen!" verbirgt, liest der vergessliche sin-o-meter-Leser am besten hier nach (der Eintrag gilt Kennern als humoristischer Höhepunkt im sin-o-meter)!
Szenenwechsel: Cathy muss auf einmal schnell zu einer Hochzeit, als ich sie gerade in die Regeln von "Kniffel" eingeführt habe (ich wollte das Sprachtraining mal etwas auflockern). So bleibe ich im "86°" allein zurück und bestelle mir ein Schwein mit Ei.
Wider die Wahrscheinlichkeit
Wo steckt denn bloß noch mal dieser Konzertsaal? Ich hätte schwören können, einmal um die Ecke der Taiping Lu biegen und schon ist man da. Wieder mal muss ich schmerzvoll erkennen, dass nachts alle Straßen grau sind, ebenso wie alle Theorie. Auf meiner Odyssee durch die Blocks wäre ich dann wieder mal fast von einem Taxifahrer auf dem Zebrastreifen umgenietet worden. Da mein Geduldsfaden längst gerissen ist, trete ich ihm feste gegen die Motorhaube. Die Taxi-Insassen schauen mich an wie E.T., den Außerirdischen. Eine weitere Episode aus der nicht enden wollenden Krieg-der-Holzköppe-Saga: Didus Skywalker gegen die finsteren Raumkreuzer einer fremden Galaxis. Dürfte ich straffrei Laserschwerter einsetzen, gäbe es in Nanjing wahrscheinlich gar keine Taxis mehr, sondern nur noch Weltraumschrott... Inzwischen ist mir trotz der nur drei, vier Grad plus so warm, dass ich mir erst mal ein Eis am Stiel gönne. Zum Silvesterkonzert komme ich sowieso nicht mehr rechtzeitig. Als ich mich dann endlich fünfzig Minuten verspätet durch die Reihen gequält, zig Leute zum Aufstehen genötigt und soeben Jacke und Schal abgelegt habe, da ertönt der Pausengong!
Übrigens nicht die erste Panne heute, denn als ich um eins in der Mensa essen gehen wollte, stellte man plötzlich fest, dass meine Mensakarte ungültig ist. "Wie das?", frage ich. "Da waren doch eben noch 90 Yuan drauf!" Achselzucken. Entnervt renne ich zur Kartenausgabe und zwinge die Herrschaften durch energisches Klopfen das Gitter noch mal hoch zu machen. Nachdem ich ordentlich Terror gemacht habe, gewährt man mir eine 6-tägige Sonderverlängerung. Das ist auch mehr als angebracht, da mich kein S... davon in Kenntnis gesetzt hat, dass die Karte plötzlich ungültig sein könnte. Zu essen gibt es nun natürlich nichts mehr. Ich esse um fünf.
Wieder zurück zum Abend: Eine Stunde, nachdem im Konzertsaal (übrigens ohne Zugabe) der letzte Ton verklungen ist, bin ich (mit einem Abstecher zum Wanda-Kinocenter, wo der neue NARNIA-Film aber erst nächste Woche startet) auf dem Weg zur internationalen Gemeinde, wo ich während der musikalischen Gebets-"Watch Night" auch dieses Jahr vergeblich hoffe, irgendwie würde diesmal etwas dazwischen kommen und das Jahr doch nicht pünktlich um Mitternacht rum sein. Nach 0 Uhr hält es dann die Afrikaner nicht mehr auf den Sitzen und sie zetteln eine Art Gospel-Polonäse an! Wildfremde Menschen wünschen mir ein gutes neues Jahr. Und wenn ich Ingrid aus Lübeck nicht demonstrativ die Hand hingehalten hätte, hätte ich schon wieder eine Umarmung einstecken müssen!

Trotz der Pannen blicke ich doch auf ein erfolgreiches Jahr zurück, das die Erkenntnis genährt hat, dass im Leben nicht immer das Wahrscheinlichste passiert. Das war nämlich meine Antwort , als Studenten im Oktober danach fragten, ob ich im Sommer gehen würde. Wie wir inzwischen alle wissen (oder notfalls im Eintrag vom 23. November nachlesen können), war das vor ein paar Monaten noch sehr wahrscheinlich. Übrigens bekam ich Montag eine E-Mail aus Deutschland: Es gab in Wahrheit doch Bewerber auf meine Stelle. Aber der HERR ist immer noch größer!
Mit dem Satz kann ich aufhören!
Das schönste Weihnachtsgeschenk
Nun zeigt mein Beitrag auf der Weihnachtsfeier (siehe Eintrag vom 16. Dezember) also doch noch Wirkung: Student Xu ("Zum Weihnachten gibt es nichts schöneres!") hat bei mir eine Bibel in deutscher Sprache angefordert, die ich ihm heute vor dem Unterricht aushändige. Im Gegenzug bietet er mir eine englische Bibel von den Mormonen an. Aber die soll er doch lieber einem Bedürftigeren geben!
|
Kostenloses Blog bei Beeplog.de
Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.
|
|
|