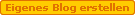| |
Kein Weltuntergang! Oder doch?
Die Welt geht unter. Aber nur im Film „2012“ des deutschen Regisseurs Roland Emmerich, der heute in aber auch jedem Nanjinger Kinosaal gezeigt wird. Das hindert alle Vorstellungen aber nicht daran, restlos ausverkauft zu sein. So was habe ich in meiner langjährigen Erfahrung als Kinogänger auch noch nicht erlebt. Überall läuft derselbe Film und trotzdem gibt es keine Karten mehr! Derlei ist zwar an sich kein Weltuntergang, aber Cathy ist trotzdem unzufrieden. „Hätte ich nur reserviert!“, jammert sie. Wir fahren von der Stadtmitte mit dem Bus Richtung Jangtse. Dort ist auch keine Karte mehr zu kriegen. Wir müssen zwanzig Prozent teurere Schwarzmarktkarten kaufen. Die Apokalypse als einträgliches Geschäft! Wenigstens gibt es bei „Kentucky Fried Chicken“ noch ein paar freie Plätze. So müssen wir den monumentalen Weltuntergang wenigstens nicht mit leerem Magen durchstehen. Schließlich enthüllt sich mir auch ein möglicher Grund für die gewaltige Popularität des Films hierzulande: Der Schluss spielt im Himalaja und inszeniert China als Wiege der Menschheitsrettung. Das fand die chinesische Kulturbehörde sicherlich förderlich (auch wenn die Szenen in Kanada gedreht wurden)...
Eva nun wieder!
Eva (alias Chen Dong) hat mir die Zerstörung ihres Koffers (sin-o-meter-Eintrag vom 21. August) offenbar verziehen. Heute vor der Sprechstunde gehe ich mit ihr in die Mensa. Sie hatte das schon letzte Woche vor. Man kann ja auch nicht immer Spielverderber sein. Und so ganz nebenbei erfahre ich, dass sie ja, so ganz allgemein gesprochen, der Meinung sei, ich solle heiraten. Was sie anbetrifft, sie möge am liebsten ältere Männer, die idealerweise zwanzig Jahre älter seien als sie. Die hätten einen weiteren Horizont und seien nicht so arrogant. Na, sage ich, das scheint ja in China öfter vorzukommen. Ich hätte so was Ähnliches erst kürzlich von jemand anders gehört. Nein, meint Eva, das sei nur bei ihr so. Su Zhao kommt vom Nachbartisch zu uns und lenkt das Gespräch dankenswerterweise auf ein andere Thema: die Noten im Geschichte-Test vom Montag. "Sie haben Glück", meint Eva später nach der Sprechstunde, als ich auf dem Weg zum Bus bin, "Sie sind beliebt." Ich verkneife mir mal den Widerspruch: „Warten Sie bis zur nächsten Prüfung!“, der mir auf der Zunge liegt.
Chris x 2
Um elf Uhr nachts ruft Danyu an und erzählt mir in einem einstündigen Telefonat von ihrem Entschluss, ihren Ami-Chris zu heiraten. Der habe Visa-Formalitäten für sie in die Wege geleitet, damit sie an der CTU studieren könne. Sie müsse ihm jetzt zusagen, um ihren Studienplatz in Chicago nicht zu gefährden. Der Franko-Engländer, der komischerweise auch Chris heißt und den sie ja lieber heiraten würde, halte sie ja nur hin und hier in Nanjing halte sie nichts und vor allem niemand. Ich sage, sie soll sich etwas Zeit nehmen, aber der Ami-Chris sei schon die richtige Wahl.
Es knirscht im Gebälk

Kracks. Es knirscht gewaltig bei mir vorm Fenster, während ich an den Korrekturen meines Geschichts-Tests sitze. Seit heute Morgen fällt in dicken Flocken Schnee vom Himmel. Der plötzliche Wintereinbruch ist dem stattlichen alten Baum vor meinem Balkon nicht bekommen und er ist einfach mit Stumpf und Stiel umgekippt. Ich hatte schon bei dem Gewittersturm im Juni Sorge um ihn. Nun haben Wind und die vereisten Schneehaufen auf seinen Zweigen ihm den Rest gegeben. Mir wird der Schatten im nächsten Sommer fehlen. Auch die Wäscheleine, auf die ein paar Äste gefallen sind, hat sich verlängert. Wie ich unten vor Ort feststelle, als ich aus der Bibliothek zurück bin, war der Stamm innen hohl und morsch. Inzwischen haben Arbeiter den Baum bereits in Brennholz zerlegt.
Danyu hält mich mal wieder von der Arbeit ab. Abends um acht steht sie bei mir auf der Matte, um mal wieder die neuesten Entscheidungen zum Thema Liebe, Last und Lebensplan zu diskutieren. Ich komme mit meinen Test-Korrekturen nur voran, als der kanadische Mittelschullehrer sie anruft, von dem sie mir gerade erzählt hat und der sie ja viel aufmerksamer behandle als ich. Vielleicht könne sie den ja heiraten, sage ich. „What?“, empört sie sich. Erwecke sie vielleicht den Eindruck, als ob es ihr nur ums Heiraten ginge? Darauf gibt es nur eine Antwort: „Yes.“ Dann ruft Liu Chao an, weil ich ja in einer Woche nach Peking komme. Wir plaudern fröhlich weiter. Danyu denkt aber nicht daran zu gehen. Stattdessen wedelt sie mir ständig selbst geschriebene Zettel ins Blickfeld. „I am hungry. What about you?“ Und nach zehn weiteren Telefon-Minuten: „Is she your sweetheart?“ Es muss halb elf sein, als ich mit ihr zwecks Mitternachtsbuffet zum Sculpting on Time aufbreche, damit sie nicht wieder in Tränen ausbricht oder Schlimmeres, wenn ich sie so nach Hause schicke. Wie schon früher an dieser Stelle gesagt: Wenn dies ein Roman wäre, würde man sagen: Die Figur ist total überzeichnet!
Fast berühmt
Heute kommt Besuch! Meine Ex-Studentinnen Shenling und Fenghua aus meiner Zeit an der YUST, heute beide in Schanghai beschäftigt, haben sich angemeldet. Da beide nicht so die Kommunikationsgiganten sind, habe ich ihnen geschrieben, wenn sie angekommen seien, könnten sich mich am Xuanwu-See antreffen, wo ich mich immer zum Sprachtraining mit Jiakun alias „Cathy“ treffe. Am See ist es allerdings heute schon ziemlich kalt und wir sind froh, dass es ein bisschen Abwechslung gibt, als die beiden plötzlich neben uns auftauchen.
Ich schicke die beiden erst mal auf eine der Inseln. Als wir sie eine knappe Stunde später wiedertreffen, kommen sie allerdings von der Einkaufsmeile Hunan Lu. Gemeinsam schauen bzw. hören wir uns den öffentlichen Auftritt der belgischen Folkjazz-Band Snaarmaarwaar in einem der Einkaufstempel von Deji Plaza an. Danach folgt der obligatorische Fotografier-Marathon. Shenling will ein Foto mit den Musikern, Fenghua stellt sich dazu, Cathy will eine CD erwerben. Ich werde von einer anderen jungen Dame aufgefordert mit ihr ein Foto zu machen. Ich versuche richtig zu stellen, dass die Jungs da drüben die Musiker seien, nicht ich. Ich sei unbedeutend. Ist ihr egal. Schließlich wird Cathy aufgefordert für ein Foto zu posieren, weil sie mit mir gesehen worden ist. „Almost Famous“ wäre der dazu passende Filmtitel. Plötzlich stehe ich Li Yuan alias Emilie gegenüber, die ich im letzten Jahr im Gottesdienst getroffen habe. Ist ja fast wie beim Schützenfest auf'm Dorf hier!

Danach stelle ich Fenghua, Shenling und Cathy noch meine Bleibe und meinen Arbeitsplatz, die deutschsprachige Bibliothek, vor. Der stimmungsvolle Tag klingt aus mit einem zünftigen Diner in einem gut geheizten Restaurant direkt oberhalb der U-Bahn. So können die beiden Besucherinnen aus Schanghai anschließend stressfrei wieder zum Bahnhof kommen.
Von Opferritualen und Zockerrunden
Heute wird ausgeschlafen und dann kommt es zum dritten großen Festbankett mit der Familie Yang. Dazu gibt es unter anderem Hammelbraten (Yang heißt ja übersetzt Hammel) und einen superleckeren Fisch, den der joviale Onkel, der auch heute wieder zugegen ist, extra frühmorgens aus der alten Kaiserstadt Yangzhou geholt hat. Die Oma bietet ihre größten Kochkünste auf, auch Opa und Oma mütterlicherseits sind angereist. Und die üblichen Onkels und Tanten. Nachdem die Bierlachen auf dem Tisch sich zu gewaltigen Strömen ausgeweitet haben und auch ich satt geworden bin, wird der Speisesaal Schauplatz eines religiösen Rituals: Vor dem hauseigenen Altar im Erdgeschoss sammeln sich Schulterstücke vom Rind oder Schwein, Obst, Bonbons und andere Leckereien. Vorne auf einem Schemel geht jeder einmal auf die Knie und verneigt sich vor den unbekannten Göttern, um das Schicksal des in diesem Jahr bisher nicht vom Glück verfolgten Familienvaters zu wenden. Man rechnet nicht damit, dass ich mich daran beteilige. Und richtig: „Ich bin Christ“, erkläre ich, da betet man nur zu Jesus. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass danach den Göttern die ganzen Leckerlis weggegessen werden. Auch ich bekomme ein paar Bonbons ab, die eben noch auf dem Altar lagen. Naja, ich kann die auch besser verwerten. Nach der religiösen Pflichtübung setzen die Männer sich zusammen und eröffnen eine Zockerrunde und spielen um Geld. Da ich schon von Natur aus nicht pokern kann, nutze ich die Gelegenheit, den etwas ratlos umherstehenden Frauen Mau-Mau vorzuschlagen. Und Yangliu und ihre Tanten reagieren auch ganz positiv auf das Spiel. Sie spielen mich sogar phasenweise unter den Tisch. Dann ist es vier und ich nehme Abschied, verspreche dem gebeutelten Vater von Yangliu, dass ich mal bei Jesus für ihn ein gutes Wort einlegen werde, und einer der Männer fährt mich mit Yangliu zum Bus-Bahnhof, wo ich nur durch forsches Auftreten verhindern kann, dass sie mir die Rückreise finanziert. „Aber ich habe Weisung von meinen Eltern, dass ich die Fahrkarte bezahle“, sagt sie. Nun, sage ich, sie müsse ja nicht erzählen, dass sie mit dem Projekt gescheitert sei. Außerdem hätte ich ihre AKN-Fahrkarte ja auch nicht bezahlt, als sie im Sommer in Großenaspe gewesen sei.
Freitags bei "Celiu"
 Zum Frühstück schickt die arbeitende Bevölkerung uns in ein Restaurant, das berühmt ist für eine örtliche Delikatesse. Dabei handelt es sich um Riesenravioli in der Form und Größe des Raumschiffs Enterprise, die gefüllt sind mit einer Krabbensuppe. Man beißt den runden Nudelteig an der Seite leicht an wie ein feindliches Klingonengeschoss und schlürft, was das Zeug hält. Dabei darf das Raumschiff natürlich nicht abstürzen, sprich vom Teller fallen. Eigentlich bin ich noch satt von gestern Abend, aber jetzt wird hier nicht schlapp gemacht! Zum Frühstück schickt die arbeitende Bevölkerung uns in ein Restaurant, das berühmt ist für eine örtliche Delikatesse. Dabei handelt es sich um Riesenravioli in der Form und Größe des Raumschiffs Enterprise, die gefüllt sind mit einer Krabbensuppe. Man beißt den runden Nudelteig an der Seite leicht an wie ein feindliches Klingonengeschoss und schlürft, was das Zeug hält. Dabei darf das Raumschiff natürlich nicht abstürzen, sprich vom Teller fallen. Eigentlich bin ich noch satt von gestern Abend, aber jetzt wird hier nicht schlapp gemacht!
Zur Verdauung flaniere ich mit Celiu ein bisschen durch die bescheidene Einkaufszone dieser 600.000-Einwohner-Stadt (Celiu sagt „Dorf“), in der jetzt am Vormittag natürlich nicht gerade der Bär tanzt. Danach geht es auf den Tempelberg, die wohl entscheidende Sehenswürdigkeit hier. Celiu lässt sich von ein paar Schnattertanten unten am Treppenaufgang überreden, buddhistische Räucherwaren zu erwerben. Sie will sie für ihren Papa verbrennen um die Götter, an die sie eigentlich nicht glaubt, aber man weiß ja nie, gnädig zu stimmen, der ja zuletzt nicht nur Glück hatte. Dabei verbrennt sie sich die Hand. Ein Zeichen, sage ich, mit ihren Göttern sei nicht viel los. Bei Jesus wäre so was nicht passiert und mächtiger ist er auch. Doch horch! Was klingelt dort? Es sind die Glöcklein oder Triangeln, die den Gottesdienst zur Mittagszeit einläuten. Wir geraten in ein buddhistisches Ritual mit viel Kling-kling und Klong-klong. Es wird viel gekniet und noch mehr ge-sing-sang-sungen. Die Mönche bieten uns hier vor ihrem Buddha eine richtige Show!
Unten am Fuße des Hügels ist so eine Art Saison-Jahrmarkt. Wir fahren Karussell und werfen Bälle in Eimer. Celiu hat sich in einen Bären verliebt, der fast so groß ist wie sie, aber sie wirft zu oft vorbei. Ich bin auch keine große Hilfe. Schließlich wird sie vollends wieder zu dem kleinen chinesischen Mädchen, das sie die meiste Zeit ihres Lebens in dieser Stadt ja war, indem sie vor dem völlig konsternierten jungen Mann auf der Stelle hüpft, quengelt und bettelt und mit quietschender Stimme wiederholt: „Ich will aber den großen Bären da.“ Ratlos bietet der junge Mann ihr diverse Geschenke auf dem Niveau von Kinder-Überraschungsei-Inhalten an. Sie schüttelt nur den Kopf. Entzückend ist sie in dieser Rolle und ich frage mich: Was ist hier kalkuliert und gespielt, was impulsives Verhalten? Der junge Mann von den Wurfeimern jedenfalls merkt rasch: Die wird er nicht wieder los. Er muss sich was einfallen lassen oder er verliert sein Gesicht. Celiu bekommt schließlich einen weißen Hund mittlerer Größe in die Hand gedrückt. Ich rate dringend dazu, den Köter anzunehmen. Wir streifen durch den Park, lassen uns von Polizisten im Müßiggang ablichten und machen Pause. Yangliu erzählt mir, dass sie manchmal von unerklärlichen Kummer-Attacken heimgesucht wird, obwohl sie sich natürlich immer fröhlich gibt, und fragt mich nach dem, was an ihr besonders sei. Ich sage: Willkommen im Leben.
Danach versucht es Celiu noch mal mit den Bällen, aber die fliegen immer wieder raus aus den metallenen Eimern. Es reicht nur für ein kolossal hässliches Stoffküken mit einer überdimensionalen Sonnenbrille. Wir nehmen einen Bus zurück, gehen schließlich die letzten paar Hundert Meter zu Fuß und überqueren eine Brücke über einen stinkenden Fluss.
Wieder zu Hause wandern wir zu Opa auf das Gemüsefeld hinterm Haus. Wie früher rupft er dort in den Rabatten und seine Enkelin erinnert sich daran, wie sie als Kind daneben saß und ihm zusah. Aber es erfüllt sie manchmal mit Sorge, dass Opa und Oma, die im Untergeschoss wohnen, noch so viel arbeiten müssen. Gerade in den letzten Jahren seien sie alt geworden, älter. Auch das bekümmere sie. Dafür studiere sie jetzt. Vielleicht könnte sie später viel Geld verdienen und Opa und Oma müssten nicht mehr arbeiten. Opa sieht allerdings eher so aus, als wäre das genau das Leben, das er nicht führen möchte. Wir wandern durch das Wohnviertel, das in der Tat etwas Dörfliches hat. Die meisten Häuser sind dreistöckig, schmal und hoch und grauweiß. Abgesehen von der in geschmacklosem Knallrosa erstrahlenden Villa von Herrn Neureich, an dem sogar die griechischen Säulen angestrichen sind wie Paulchen Panther. Zwischen den Wohnzeilen liegen Gemüsebeete und ein künstlicher See, etwa 1000 Quadratmetter groß, an dem sogar gewaschen wird. Ob die Wäsche danach wirklich sauberer ist? Überall begrüßt Yangliu Bekannte und an jeden Gruß fügt sie sogleich ungebeten die Erklärung an: „Das ist mein Lehrer!“, damit es keine dummen Fragen gibt oder – noch schlimmer – Missverständnisse. Mit einer steinalten Dame, die vor ihrem Haus Erben palt und Kräuter sortiert, spricht sie etwas länger. Die Greisin muss noch arbeiten, weil ihr Sohn Alkoholiker oder ein Nichtsnutz oder beides ist und sie nicht versorgen kann.
Am Abend wird gemeinsam diniert. Ein Cousin, Onkel und Tanten sind gekommen. Der Cousin, 13 Jahre alt, ist leicht übergewichtig und schwer computerzentriert. Er sitzt, seit er satt ist, vor dem Computer und spielt und als er später weg ist, muss ich es auch noch spielen, das beliebte Computerspiel „Pflanzen gegen Zombies“. Darin muss man mit Bomben schmeißenden Gemüsesorten oder explodierenden Kirschen sein trautes Heim vor hirnlos heraneilenden Zombies retten. Der letzte Schrei! Na dann gute Nacht!
Mach leer, den Becher!
Heute geht es im Unterricht mal nicht mit dem Uni-Bus nach Hause, sondern mit dem Linienbus zum Busbahnhof Dongzhan. Und von dort in die Heimat von Yangliu, einer Studentin, die im Sommer auch in Großenaspe war. Revanchebesuch gewissermaßen. Vor der langen Reise: Premiere für mich in der Mensa auf dem neuen Campus Xianling. Mit am Tisch sitzt auch Yixuan, ebenfalls im Sommer bei mir. Als es dunkelt, kommen wir über die vergitterte Zufahrt bei der Firma vom Papa an. Die Mama ist auch da, sie wirkt jugendlich und trägt eine schwarze Motorradlederjacke. Ihre Tochter nennt sie „Xiao Liu“ (bzw. im hiesigen Dialekt „Celiu“), was „Kleine Liu“ heißt und berechtigt ist, denn Yangliu ist höchstens 1,60 m groß. In der Firma gibt es auch eine Hündin, die sich vor Freude Yangliu wiederzusehen gar nicht mehr einkriegt. In der Firma, einem klassischen Familienbetrieb, bei dem jeder hier und da mithilft, stehen überall riesige Rollen mit Eisendraht herum. Ich erfahre, dass diese hier verarbeitet werden zu Stahlbetonträgern. Die Baubranche boomt auch in der Provinz. Leider, mit betrübtem Blick hat mir Yangliu das während der Busfahrt erzählt, ist der Papa, sonst ein optimistischer Mann, momentan arg eingeschränkt. Beim letzten Telefonat mit seiner im zwei bis drei Stunden entfernten Nanjing war er so abgelenkt, dass sein Zeigefinger in eine Maschine geriet, jetzt ist er zwei Glieder kürzer. Man hat Finger und Patienten zusammen nicht schnell genug ins Krankenhaus bekommen. Jetzt trägt er immer noch einen dicken Verband und die Hand in einer Schlaufe.
Ein Onkel kommt herein und zündet erst mal eine Fluppe an. Ich bin der Renner des Tages und die Gelegenheit wird genutzt um im ersten Stock eines in der Nähe gelegenen Restaurants im Kreise der erweiterten Familie und einiger Freunde zu schlemmen. Neben Yang Liu sitzt ihr jovialer Onkel, Typ Schenkelklopfer und Bierkonsument ersten Grades. Seine Zähne sind schwarzgelb vom vielen Rauchen und in seinen schmalen Augen sieht man die roten Äderchen. Immer wieder ruft er „Ganbei“ („Mach leer, den Becher!“) und macht dann auch wirklich leer. Im Verlauf des Abends wird so noch ungefähr tausend Mal angestoßen. Einer mit allen, alle mit einem. Ich trinke Saft und rauchen tu' ich auch nicht. Seltsamer Deutscher. Es gibt die üblichen 32 Gänge, der Tisch sieht am Ende aus wie nach einem Germanengelage. Längst sind alle männlichen Teilnehmer in der Runde mindestens angeschäkert. Schließlich fährt uns ein Onkel oder Cousin, ich habe keinen Überblick mehr, mit seinem Auto heim. Der Typ ist natürlich voll wie tausend Tümpelkröten, aber dass er trotzdem den Motor anlässt und das Steuerrad in die Hand nimmt, ist so normal wie Regen im deutschen Sommer. Und ich sitze auch noch vorne! Ehrengast! Ich schnalle mich an und bete zum Ewigen, dass er die Kontrolle behält, die der Fahrer leicht verlieren könnte. (Ironie am Rande: Im Juni hatte Yanglius Vater einen Mopedunfall. Schuld war ein Betrunkener.) Alles geht gut. Ich beziehe in dem dreistöckigen Haus am Stadtrand ein eigenes Zimmer. Heizung gibt es nicht, aber immerhin warmes Wasser. Doch ich dusche lieber morgen früh.
Drama-Queen
Was habe ich jetzt wieder angestellt! Ich stehe kurz vor Mitternacht bei eisiger Kälte an einer belebten Nanjinger Kreuzung, an der sich ein paar Bauarbeiter zu schaffen machen, und mir gegenüber steht eine leidlich erfolgreiche Literatin, elf Jahre jünger als ich, die soeben in Tränen ausgebrochen ist. Und das kam so: Ich habe also Danyu zu dem Besuch dieses Schriftstellers George Lindt eingeladen, denn sie als Autorin und ein deutscher Autor, das passt doch. Und er, der heute in Nanjing eine Lesung hatte, eigentlich ja zwei Lesungen... Na, ich sehe schon, wir müssen doch ganz zurück zum Anfang:
Um neun Uhr morgens haste ich, nachdem mein Wecker mich zu spät geweckt hatte, zum Hörsaal 736, wohin ich für neun Uhr wegen der heutigen Dichterlesung bestellt wurde, nur um festzustellen: keiner da. Kurz danach eine Mitteilung per SMS: Wir sind hier noch in einer Druckerei, kommen etwas später. Dann habe ich ja noch etwas Zeit für die Beschaffung von Laptop und Mikro. Kurz darauf kreuzen die Organisatoren mit dem Autor auf: die örtliche Goethe-Tante, die Organisatorin der Lesereise aus Peking, eine Tussi Typ abgebrochenes Soziologie-Studium und dreimal vom selben Freund getrennt, die Pullover trägt, die zum knallroten Rand ihrer 120-Dioptrin-Brille passen und (was ich besonders toll finde) erst alles wild macht und dann im Nebensatz fallen lässt, dass man das alles doch nicht brauche, sowie Autor Lindt, der erst etwas spröde und scheu wirkt, aber noch gehörig auftauen wird, sobald ich vor den Studenten und zwei Kollegen die Veranstaltung eröffnet habe: Dann hört er nämlich als Ergänzung zu seiner eigenen Lesestimme die von mir und meiner Kollegin Chen gestern in einem Lesewettbewerb gecastete Jia Ni, die zusammen mit „Leonora“ von den Magisterstudenten die chinesische Überetzung lesen darf. Man muss wissen: Jia Ni, die für mich alles andere als eine Überraschungssiegerin in dem Wettbewerb war, liest nicht, sie spielt, was sie liest. Und Jia Ni wird auch noch auftauen: Sie erfährt nämlich, dass sie es hier mit dem Regisseur des Dokumentarfilms „Beijing Bubbles“ über Pekinger Rockmusiker zu tun hat, und dieser Film sagt ihr viel mehr als der Roman, aus dem sie heute vorliest.
Lindt, der aus Marburg stammt, zeigt passend zu seinem kurzweiligen Roman „Provinzglück“ über einen Berliner Marketingmeister, dessen Leben durch ein Lockangebot aus einer Kleinstadt auf den Kopf gestellt wird, ein paar Provinzbilder, macht noch eine Extra-Tonaufnahme von Jia Ni und erzählt später auf dem Weg zum gemeinsamen Essen, wie die unkorrigierten Druckfahnen durch ein peinliches Missgeschick des Fischer-Verlags in Druck gerieten, was die vielen Fehler in dem Roman erklärt, auf die ich ihn angesprochen habe. Was nun aus Katharina und Jan, den Hauptfiguren des Romans geworden ist, lässt sich leider aus dem bescheiden gebliebenen Multitalent nicht herauslocken. Beim Essen punktet Rote Brille wieder kräftig bei mir, indem sie sich höflich erkundigt, ob es jemanden stört, wenn sie raucht, nachdem die Fluppe schon halb brennt. Ich muss dann auch mal...
Nachmittags liest Lindt noch mal in der großflächigen Tiefgarage unterhalb des Sportgeländes Wutaishan, in dem ich immer jogge. Wahrscheinlich war die Lüftung nicht ausreichend, um hier in den Katakomben des Stadions statt Büchern tatsächlich Autos zu parken. Zwischen den auf den Asphalt gemalten Parkmarkierungen stehen jetzt Stände mit Büchern, soweit das Auge reicht. Es gibt auch ein Café und eine gemütliche Sitzecke. Dort gibt es die zweite Aufführung der Lindt-Lesung. Ich sehe auch ein paar bekannte Studentengesichter. Natürlich habe ich Danyu auch von dem Termin Bescheid gegeben. Plötzlich sitzt sie neben mir. Später stelle ich sie Lindt vor und der kauft sogar noch zwei ihrer Bücher, die in so einer üppig sortierten Buchhandlung natürlich nicht fehlen. Verstehen sich ganz gut, die beiden. Dann wandern alle ab. Und ich trinke mit Danyu einen Tee. Sie ist ungehalten, dass ich für ihren Plan, hier für mich einen Vortrag zu organisieren, nicht sofort Feuer und Flamme bin. Deswegen sei sie hauptsächlich gekommen. Der Autor habe sie doch gar nicht interessiert. Ich bezeichne sie mehrfach als Drama-Queen, obwohl ich noch gar nicht wissen kann, wie recht ich damit habe. Ich will nach Hause. Aber sie lässt mich nicht. Sie will mit mir essen gehen aus Dankbarkeit, weil ich ihr neulich eine Empfehlung geschrieben habe. Aber ich bin noch satt vom Mittagessen. Kompromiss: Wir gehen in das unterirdische Eiscafé an der U-Bahnstation. Da muss ich mir zum x-ten Mal anhören, warum sie ihren Freund, den US-Chris, der sieben Jahre jünger ist als sie, nicht heiraten wolle und den französischen Chris, mit dem sie sich seitenlange E-Mails schreibt (die ich gelegentlich als Kopie erhalte), nicht heiraten könne bzw. er sie nicht oder noch nicht usw. Dann will ich endlich weiterkorrigieren. Sie verlangt, dass ich sie mit dem Taxi nach Hause bringe. Ich sage: Auf gar keinen Fall, sie wisse doch, dass ich zu tun habe. Ich wende mich ab, sie hinterher. Tja, und das ist der Moment. Sie erleidet so eine Art nervösen Zusammenbruch. Fünf bis zehn Minuten lang flennt sie dort in der eisigen Kälte, in der wir vorher schon zehn Minuten lang sinnlos herumgestanden haben. Ich denke: Kann hier mal jemand den Vorhang ziehen? Denn wir haben Zuschauer! Die Bauarbeiter direkt vor uns wundern sich, Radfahrerinnen fahren vorbei und schauen neugierig zu dieser offensichtlichen klassischen Tragödie herüber. Ich sehe natürlich aus wie der böse ausländische Herzensbrecher par excellence. Aber, hey!, das ist hier gar keine Tragödie, das ist reine Hysterie, möchte ich denen am liebsten hinüberrufen, aber ich weiß nicht, was Hysterie auf Chinesisch heißt. Sie sei nichts wert, sie sei Dreck und wertlos, wiederholt sie und sie verliere hier gerade in aller Öffentlichkeit das Gesicht meinetwegen, das sei beschämend. Ich gebe ebenso wiederholt zu verstehen, dass sie da jetzt doch etwas übertreibe, woran man schon merkt, dass ich mit dieser Situation etwas, wenn nicht sogar weitgehend überfordert bin. Das ist jetzt irgendwie alles doch bisschen viel für mich, insgesamt gesehen. Und, also, machen wir's kurz, ich bringe sie natürlich doch mit dem Taxi nach Hause. Aber sie muss zahlen!
Hesse und die Pietisten
Na, da ist er doch ein bisschen sauer, der emeritierte Herr Hsia von der McGill-Universität in Montreal, dass ich das nicht stehen lassen hab', Pietisten seien eine Sekte. Denn mit diesem sachlichen Fehler eröffnete der an der FU Berlin promovierte Germanist in allerdings grammatisch einwandfreiem Deutsch seinen Vortrag über Hermann Hesses „Siddhartha“ mit dem Titel Over 80 years' Discussion of its Christian, Indian and Chinese Connections by Scholars of three Continents. Es war auch sonst kein doller Vortrag. Dass Hesse unter der strengen pietistischen Erziehung seiner Eltern gelitten hat, kann man ja noch stehen lassen. Doch dann bestanden zwei Drittel des Vortrags aus einer Rekapitulation des Inhalts von Hesses indischer Dichtung, dann kam noch eine windige These zum interkulturell Verbindenden dieses zeitlosen Texts und Bilder zur Auflockerung hatte der betagte Gastreferent auch nicht im Gepäck.
Ich suche noch kurz das Gespräch mit dem Gelehrten aus Kanada und steige mit ihm in den Aufzug. Er fragt mich ob ich Schwabe sei, weil ich die Pietisten verteidigt hätte. Ich wiederhole noch mal in anderen Worten die kleine Korrektur aus der Diskussion nach dem Vortrag, dass Pietisten durchaus auf dem Boden von Bibel und Bekenntnis stünden, eine etablierte Gruppe innerhalb der offiziellen Landeskriche seien und somit beim besten Willen nicht mit einer Sekte wie etwa den Zeugen Jehovas auf eine Stufe gestellt werden könnten und versuche dabei verbindlich und freundlich zu sein, aber als er dann feststellt, dass ich nicht mit ihm aus dem Fahrstuhl steige, ist er, glaube ich, doch ganz froh.
"FC B" im Pech!
Statt Unterricht: Prüfung! Am Vormittag fährt mich und einige andere ausländische Kollegen ein Sonderbus in die Fremdsprachenmittelschule, wo vier Kandidaten sich einem Test zur direkten Zulassung zu einem Germanistikstudium an unserer Universität stellen müssen. Die zwei Besten kommen weiter, die anderen scheiden aus. Im Lehrerzimmer, wo ich vor der Prüfung mit meiner chinesischen Kollegin Platz nehme, gibt es bergeweise Obst und Joghurt zum Frühstück und so ganz nebenbei werden uns Aufwandsentschädigungen ausgehändigt, die Scheine diskret im Umschlag. Die schriftliche Prüfung habe ich entworfen. Sie ist am Ende entscheidend, da sich mündlich alle ungefähr gleich gut schlagen. Der einzige männliche Teilnehmer gibt sich als Fan des FC Bayern München zu erkennen; das gibt natürlich Sonderpunkte im Bereich Landeskunde, weil er damit zeigt, dass er weiß, wer die beste deutsche Fußballannschaft ist.
Aufpasser sorgen dafür, dass wir Prüfer uns nicht absprechen und separat zu Ergebnissen kommen: China lernt dazu. Mir ist das nur recht. Getrennt haben wir daber beide schon die beste Kandidatin ermittelt, nur bei Platz zwei weichen wir voneinander ab. Nach einem von der Schule spendierten Mittagessen im Restaurant gegenüber korrigieren ich die versiegelten Prüfungen in unserem Institutsbüro. Die Namen sind weggeweißt, damit man unbefangen urteilt; aber es ist natürlich trotzdem nicht schwer zu erkennen, wer der FC Bayern-Fan ist. Es ist aber nichts zu machen: Zwei der Mädchen haben einen besseren Aufsatz geschrieben.
Auf dem Campus 'ne Menge los
Und noch eine Jubelparty. Die Universität feiert ein Doppeljubiläum: den 20. Jahrestag der Gründung des Deutsch-Chinesischen Instituts für Rechtswissenschaft sowie 25 Jahre Hochschulpartnerschaft zwischen den Universitäten Göttingen und Nanjing. Rot-gelbe englisch-chinesische Spruchbänder über der Campus-Hauptstraße künden von dem Großereignis.
Im altehrwürdigen Auditorium, in dem wir schon „Leonce und Lena“ beigewohnt haben, finden heute Vertragsverlängerungen und Ansprachen sowie eine Podiumsdiskussion statt. Hao Hui alias „Inge“ schwirrt auch schon wieder herum: Sie ist diesmal für die Ausgabe der Übersetzungsempfangsgeräte (sieht aus wie ein Weltempfänger, funkt aber nur auf einer Frequenz und auf der höre ich meine beiden Kollegen aus der weißen Box neben der Bühne, die an die Kabinen aus dem großen Preis erinnert, die immer hermetisch abgeriegelt wurden, bevor Wim Thoelke Umschlag 1, 2 oder 3 zückte) zuständig und händigt mir eins aus. Dann kommen die üblichen Ansprachen. Aber wer genau hinhört, der merkt, dass Ex-Botschafter Ma Canrong, der höchstrangige Gast auf chinesischer Seite, klare Anweisung aus der Parteizentrale haben dürfte, ein paar kritische Töne hinsichtlich der Querelen um den Auftritt von nicht regimetreuen Autoren auf der Frankfurter Buchmesse (Gastland: China) fallen zu lassen. Gleich zweimal wirft er in einer Podiumsdiskussion, die allerdings mit einer Diskussion nicht mehr Ähnlichkeit hat als die Erde mit dem Mond und eigentlich nur ein Ringvorlesung im Eiltempo ist, den Deutschen in der Runde (Generalkonsul von der Heyden, dem Göttinger Uni-Präsidenten Kurt von Figura, meiner Austauschdienst-Kollegin aus Guangzhou, die ich gestern noch kurz über den Campus geführt habe, und einem Wirtschaftsvertreter von BASF) den Fehdehandschuh hin und kritisiert die feindselige Berichterstattung über China in den deutschen Medien, die „ein großes Problem“ sei, das genannt werden müsse. Die deutschen Vertreter erweisen sich als brave Lämmer: Nach dem Motto: „Ich will ihn nicht, nimm du ihn!“ kommt nach dem zweiten Fehdehandschuhwurf lediglich noch eine diplomatisch verklausulierte Replik vom Generalkonsul, der verschwommen von der „Bereitschaft“ spricht, in diesem Bereich „auch andere Akzente“ zu setzen (bei der Beschäftigung der Journalisten mit China oder beim Umgang der Regierung mit den Medien?). Mehrfach fällt der Begriff Menschenrecht, immerhin ein Kernthema innerhalb des deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialoges, aber die Verbindung zum Menschenrecht Pressefreiheit bleibt ungenannt. Schließlich noch der Satz: „Natürlich können wir den deutschen Medien nicht vorschreiben, wie und worüber sie berichten“ (immerhin), aber „Rahmenbedingungen“ könnten sich ändern, wobei dann aber wieder nicht klar wird, ob chinesische Rahmenbedingungen gemeint sind oder – Gott bewahre! – deutsche. Man hätte ja, wenn der Ex-Botschafter Ma schon so klar auf die Buchmesse Bezug nimmt, immerhin auch mal diskret darauf aufmerksam machen können, dass es keine Idee der „deutschen Medien“ war, eine Sitzung mit regimekritischen Autoren platzen zu lassen. Darauf sind die chinesischen Vertreter ganz von allein gekommen.
Dann gibt es eine hochwertige musikalische Einlage von adrett gekleideten Chinesinnen und die Misstöne sind vergessen. Draußen vor der Tür des Auditoriums betreuen die Studenten des Abschlussjahrgangs einen Info-Stand. Ich begrüße sie kurz und nehme ein paar Bestechungsgeschenke in Empfang, ehe es zum feudalen Jubiläumsessen ins Nanyuan-Restaurant auf dem Campus geht, wo ich Studentin „Eva“ als Ordonnanz neben den vielen Köstlichkeiten stehen sehe. Ob für sie wohl auch etwas davon abfällt?
Am Nachmittag gibt es verschiedene Workshops. Frau Bogner von der Universität Göttingen diskutiert mit Professoren und Studenten über den neu eingerichteten Doppelmagisterstudiengang Interkulturelle Germanistik und gleichzeitig wird erkennbar, dass bei den deutschen Vertreterinnen, die bis auf eine Ausnahme etwas gefunden haben, was ihnen an diesem Samstagnachmittag wichtiger war als an einer Sitzung ihres Fachbereichs teilzunehmen, im Bereich des interkulturell angepassten Verhaltens noch Defizite zu beklagen sind. Man benötigt nicht viel Fantasie um sich vorzustellen, was da vorgefallen ist: Die Studentinnen wurden wie üblich erst drei bis vier Tage vorher von der Zusammenkunft unterrichtet und haben sich ob des Termins am Samstagnachmittag gesagt: „Die Chinesen brauchen wohl noch etwas Nachhilfe, was die Bedeutung des Wochenendes für deutsche Studenten betrifft.“ Interkultureller geht es gar nicht mehr als in diesem Fallbeispiel: Wo chinesische Studenten nichts anderes als einen Pflichttermin wahrnehmen können und auch noch Aufgaben zugeteilt bekommen, tippen sich Deutsche nur verständnislos an die Stirn. Wenn interkulturelle Kommunikation funktionieren würde, dann wären die Deutschen zugegen und auch Institutsleiterin Yin hätte sich eigentlich nicht wundern dürfen: „Warum sind die Deutschen nicht hier? Die sollen doch teilnehmen!“ Die einzige Deutsche, die gekommen ist, entpuppt sich dann auch noch als Polin.
Anschließend gibt es auf der internen Lehrerkonferenz der Deutsch-Abteilung einen Disput zwischen zwei professoralen Lagern, dem ich nicht ganz folgen kann. Ich esse in der Zeit Mandarinen vom Buffet.
Am Abend laufe ich einer schwer atmenden Huang Hua über den Weg. „Herr Mehrens!“, ächzt sie. Sie trägt zusammen mit Liu Min eine schwere, schwere Kiste über den Campus; es handelt sich um die Lostrommel der Verlosaktion anlässlich des Jubiläums (Hauptgewinn: eine Woche Deutschland). Sie sei zu klein, klagt sie. Oder einfach zu schwach?, erwidere ich. Ich meine natürlich: zu geschwächt nach so einem arbeitsreichen Tag als Hilfskraft auf der Jubelparty, nehme den beiden die Kiste sofort ab und trage sie bis ans Ziel.
Heiraten für Anfänger
Die nächsthöhere Stufe wäre dann Spießrutenlaufen, denn nur Spießrutenlaufen ist noch schlimmer als eine Hochzeit in China (aus Sicht des Bräutigams). Der Ehemann der Vizedekanin hat seine Frau und mich freundlicherweise in dem Party-Restaurant abgesetzt. Er selbst nimmt nicht teil, weil es sich ja nicht um seinen Kollegen handelt, der da heiratet. In Deutschland ziemlich unvorstellbar. Im Saal dominieren weiß, rosa und andere Bonbonfarben das Bild. Links und rechts der Bühne laufen Filmausschnitte über das traute Paar, dazu Musik. Das Mikrofon des Conférenciers, des Mannes in Weiß, ist genau so laut, dass es gerade nicht mehr erträglich ist und man sich am liebsten fortwährend die Ohren zuhalten möchte. Das traute Paar marschiert ein wie Gladiatoren in die Kampfarena. Vorher muss der Bräutigam, ein junger Kollege, aber erst noch beweisen, dass er Spaß versteht und auch bei „China sucht den Superstar“ gut im Rennen läge: Er muss über einen leuchtenden Laufsteg aus Glas und singen, als gelte es nicht das Herz seiner Braut, sondern den ersten Platz bei besagter Fernsehshow zu erobern. Hinzu kommen im Laufe des Abends noch eine Reihe von Geschicklichkeitsprüfungen, bei denen ich wahrscheinlich überall durchgefallen wäre. Die Braut hat es auch nicht leichter: Im Laufe des Abends muss sie sich in drei verschiedenen Hochzeitskleidern präsentieren.
Dann sind die Gäste an der Reihe: Freiwillig dürfen die an einer Modenschau-Imitation mitmachen. Einer Dame mit beträchtlicher Leibesfülle und noch beträchtlicherem Charme fliegen die Herzen der gut gelaunten Gäste nur so zu, die gertenschlanke Bald-Ehefrau eines Kollegen, die meiner Ansicht nach ja die buchstäblich bessere Figur gemacht hat, schafft es in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen nur auf Platz zwei. Abgestimmt wird wie einst bei Wetten dass..? durch Gejohle und Applaus. Für Kinder gibt es Plüschtiere zu gewinnen, die zweimal so groß sind wie sie selbst und wem das noch nicht genügt, für den gibt es ein Zwanzig-Gänge-Menü. Zwischendurch das obligatorische Ganbei mit den Kollegen an den Nachbartischen. Wer nicht anstößt, stößt wenigstens ab und zu auf, zum Beispiel ich mit meiner notorischen Cola im Glas, über die ein weinseliger Kollege schon wieder die Nase rümpft. Und nach drei Stunden ist der Spaß dann auch schon wieder aus und die Gäste gehen nach Haus.
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
Peter, mein Tennispartner hat eine internationale Wandertruppe zusammengestellt und bestellt mich für ein Uhr zum Pipa-See am Fuße des Purpur-Bergs. Mit Bus Nr. 6 soll ich da gut hinkommen können. Aber ich renne erst mal in die falsche Richtung und lande in einem verlassenen Resort, das schon bessere Tage gesehen zu haben scheint. Dann finde ich den Durchlass durch die Mauer, von dem Peter schrieb, doch noch. Aber es ist schon fünf nach eins. Ich wandere erst mal auf Verdacht los und denke, dass ich auf so eine Horde westlicher Jugendlicher schon aufmerksam werde, wenn sie mir über den Weg läuft. Und dass ich sie im Anbetracht meines beträchtlichen Wandertempos irgendwann überholen müsste, falls sie schon vor mir sind, scheint mir so klar wie Kloßbrühe. Schließlich sind in der Gruppe auch Mädchen... Spätestens auf dem Gipfel würde ich sie ja treffen, so meine Logik, denn der ist ja das offenkundige Ziel des heutigen Wandertages. Ich wandere also querfeldein, springe mal wieder über Zäune und Absperrungen, die mir im Weg sind und bin um drei auf dem Gipfel des Berges. Ich habe auch mal kurz Pause gemacht unterwegs, habe ich sie deshalb unterwegs nicht getroffen? Oder sind sie einfach auf anderen Pfaden unterwegs als ich. Eine halbe Stunde sehe ich mich auf dem Gipfel um und schaue mir bei klarer Sicht Nanjing von oben an, Aug in Auge mit dem neuen Zifeng-Turm, der übrigens genauso hoch ist wie der Purpur-Berg (448 Meter). Zwei Französinnen und noch ein paar Ausländer laufen mir auf dem wie immer viel bevölkerten Gipfel-Areal über den Weg und ich bin von jeder schwarzen Brille wie elektrisiert, da Peter so ein auffälliges Gestell trägt, aber vom echten Peter keine Spur. War ich wirklich so langsam? Ich wende mich etwas frustriert den Betonstufen zu und beginne den Abstieg. Gott hört auch keine Gebete mehr, denn ich hatte doch erbeten, dass er mir ein bisschen hilft, die Truppe zu finden. Ich bin keine Minute unterwegs nach unten, ein paar unbekannte Amerikaner haben mich gerade passiert, da blicke ich einem ungläubigen Peter ins Angesicht, der mich sofort stürmisch umarmt wie der Vater den verlorenen Sohn in Lukas 15. Er hatte natürlich nicht mehr mit mir gerechnet. Ich schließe mich der nicht gerade kleinen Gruppe an, die gleich drei Bens enthält, ich muss mir also nicht viele Namen merken. Ein Chinese namens Daniel fängt gleich auf dem Gipfel an Gottes Schöpfung zu preisen. Einer der Bens ins Anglo-Franzose. Er hat eine junge Studentin aus Guangzhou an seiner Seite, die sehr gutes Englisch spricht. Er selbst ist ein Abenteurer ersten Grades, hat sich vorher in Thailand und Indien herumgetrieben, soll eigentlich in Frankreich studieren, hat aber kurz vor Beginn des Semesters Reißaus genommen und nun ist er hier, unterrichtet Englisch, hat aber viel Stress und muss viel um Anerkennung kämpfen, weil er eben keinen Abschluss hat.
Ich bin heute also zweimal ganz oben, einmal allein, einmal als Gruppenwanderer. Wir kommen erst spät, bei Einbruch der Dunkelheit, ins Tal zurück und landen an einem anderen See, dem Zixia-See, in dem einige verwegene Chinesen sogar zu schwimmen wagen. Ben aus Frankreich holt in einem Park am See, der vorläufigen Endstation, seinen Frisbee heraus, der andere Ben spricht ein Dankgebet, dann ist es dunkel und auf einmal unglaublich kalt. Wir haben ja keinen Sommer mehr. Und ich war auf so einen langen Tag nicht vorbereitet. Frierend folge ich der Gruppe. Peter geleitet uns in ein Restaurant. In der Stadt, die gleich hinter der nächsten Ecke beginnt, ist es sogleich fünf Grad wärmer. Daniel und ich suchen ein Klo und müssen gleich noch mal fünf Minuten wandern gehen – bis zur nächsten Tankstelle. Wir essen Nudelsuppe und Xiaolongbao. Dann setzt Peter uns in die richtigen Busse. Ben aus Frankreich findet, ich bin ein cooler Typ, und ich solle mich mal melden. Seine Freundin aus Guangzhou, die im Bus neben mir sitzt, bittet mich sogar, sie mal an ihrer Uni zu besuchen. Na, daraus wird wohl nichts. Wandertag Ende.
Völkerverständigung mit kleinen Fehlern
Heute treffe ich mich mit Constanza aus Buenos Aires. Ich hole sie vom Uni-Bus ab, zeige ihr meine Bibliothek und gehe mit ihr Xiaolongbao essen, das sind chinesische Riesenravioli mit Suppe zwischen Fleischfüllung und Teig, die rausspritzt und die Hose einsaut, wenn man falsch reinbeißt. Constanza, die heute eine langweilige Spangensteckfrisur hat, erzählt von ihrem Vater, einem Wäsche-Macho, der nur seine eigene Wäsche wäscht und nie die von anderen, von ihrem Jahr als Lehrerin in Japan, von ihrer Reise nach China, auf der sie nach Nanjing kam, und sich überlegte: Hier müsste man auch mal ein Jahr hin. Sie erzählt weiter, dass dann ohne weiteres Zutun plötzlich dieses Angebot an ihrem Institut ankam, für ein Jahr in der Spanisch-Abteilung der Uni Nanjing Geschichte zu unterrichten – der Mensch denkt, Gott lenkt. Nach dem Essen führe ich sie auf den wunderbaren Campus der Nachbaruniversität, der so genannten Nanjing Normal University, wo es einen Ententeich ohne Enten gibt. Eine Frauentruppe, wahrscheinlich ein Ehemaligentreffen, lässt sich von uns ablichten, d.h., mit dem von mir gemachten Foto waren sie nicht so zufrieden, also musste Constanza ran. Ich lichte dafür Constanza vor einigen altehrwürdigen Uni-Gebäuden ab. Mit meinem Spanisch bin ich trotz einiger Mängel im Wortschatz ganz zufrieden und hoffe Constanza, die sich schließlich bei mir noch wie abgesprochen Pans Labyrinth und Zerrissene Umarmungen ausleiht, hat bald wieder Zeit. Irgendwie nervt es aber auch, dass ich Spanisch immer noch besser (vor allem verstehen) kann als Chinesisch. In spanischsprachigen Ländern war ich insgesamt vier Monate, in China über 40 Monate. Ich müsste also eigentlich zehnmal so gut Chinesisch können wie Spanisch.
Am Abend dann die große Pleite: Das von mir initiierte Treffen zwischen chinesischen Deutsch-Studenten und deutschen Chinesisch-Lernern muss fast ohne Deutsche auskommen. Irgendwie muss ich die Sache vergeigt haben. Letztes Jahr kamen die Deutschen in Scharen und wie von allein. Diesmal hat das Versenden einer E-Mail an alle Deutschen, deren Adressen mir vorlagen, und das Hoffen auf Mundpropaganda offensichtlich nicht die erhoffte Wirkung erzielt. Nur zwei Deutsche kommen und eine von ihnen ist Polin. Reihenweise ziehen enttäuschte Studenten ab, der Jahrgang 08 vertreibt sich mit ein paar Spielen den Frust und zwei Stunden später sind nur noch ein paar Schach-Könige übrig. Im Nebenraum vertilge ich Pizza und Pommes und meine Studentinnen des Jahrgangs 07 nutzen die Gelegenheit um zu fragen, was sie schon immer über ihren Lehrer wissen wollten, aber sich bisher nicht zu fragen trauten: warum ich nicht verheiratet bin, ob ich in Deutschland eine Freundin habe, die auf mich wartet, und warum ich immer mit denselben langweiligen Klamotten herumlaufe. Sie wissen, wie viele Paar Schuhe und wie viele Hosen ich besitze. Sogar ein fehlender Knopf auf einem meiner Hemden ist ihnen aufgefallen. Bei Lehrern komme es doch auf den Inhalt an, wehre ich mich, nicht auf die Verpackung. Aber langweilige Verpackung sei demotivierend, werde ich ausgekontert. Zum Glück setzt sich Zhiyu vom Jahrgang 08 zu mir. Er trägt immer dasselbe Adidashemd (er hat zwei davon, also ist es nur das gleiche Adidashemd) und wir einigen uns darauf, dass Frauen derart pragmatische und von der Vernunft gesteuerte Verhaltensweisen einfach nicht verstehen können. Besonders überrascht bin ich von Eva, der Frau, deren Koffer ich unlängst zerstört habe. Sonst schweigsam wie eine versiegte Quelle sprudelt sie heute wie ein Wasserfall. Conny, die im Sommer mit Eva in Heidelberg war, weiß das zu erklären: Eva habe kürzlich zum ersten Mal in ihrem Leben Bier getrunken. "Na", sage ich, "die Wirkung hält aber lange an!"
Obwohl die Stimmung doch ganz gut war, gehe ich ziemlich verdrossen nach Hause, weil das Ziel dieser Zusammenkunft verfehlt wurde. Denn das Ziel war ja nicht, mir Löcher in den Bauch zu fragen.
Gipfelsturm
Und nun muss ich auch schon wieder abreisen. Ich nehme den Zug um 12.35 Uhr, der am nächsten Tag um halb 12 in Peking sein wird. Die schlechte Nachricht: Wegen des Feiertagsreiseverkehrs habe ich keine Schlafwagenkarte mehr bekommen. 23 Stunden sitzen! Weil das eine Tortur wird, gehe ich vormittags zum Abschluss noch einmal auf den Maoershan, den kuppelförmigen Berg vor der Stadt, der sich ebenfalls beträchtlich weiterentwickelt hat. Die matschige Wanderpiste von einst wurde durch feste Holzstege ersetzt und ich bin von Touristen umgeben. Wo früher zwei, drei Ausflügler sich tummelten, sind es heute zwanzig oder dreißig. Ich steige also die Stufen hinan und auf dem Gipfel ist auch alles anders. Da oben wurde nämlich ein Aussichtsturm im Stile des Ketelvierth-Aussichtsturms errichtet, nur größer, versteht sich. Das macht die Aussicht allerdings entsprechend besser. Von hier oben kann ich nun sogar die Universität sehen. Beim Abstieg wollte ich eigentlich meine Gedanken etwas schweifen lassen, aber ein kahlköpfiger Chinese zwingt mir ein Gespräch auf, will mal wieder gleich wissen, wo meine Familie sei und so weiter. Ich erkläre zum 100.000sten Mal, dass ich das mit dem Verheiratetsein nicht so praktisch finde und überhaupt, was soll das? - und werde zum 100.000sten Mal nicht verstanden. Der drahtige Glatzkopf fragt weiter, ob ich wohl homophile Neigungen hätte. Ich verneine, aber ich bin inzwischen nicht mehr ganz sicher, was er selbst für einer ist. Wo sind eigentlich seine Frau und sein Kind? Da kommt auch schon Bus Nr. 48 und erlöst mich. Ich frage nach dem kürzesten Weg zum Bahnhof, muss dann einmal umsteigen, werde nervös, weil der Bus, in den ich gestiegen bin, im Schneckentempo fährt, am Ende reicht die Zeit aber doch noch für ein paar Einkäufe für die lange Zugreise. Direkt vor einem der Läden am Bahnhofsplatz erkennt mich dann ein älterer dürrer Mann als ehemaligen YUST-Lehrer wieder, an den ich mich nun überhaupt gar nicht und nicht die Bohne erinnern kann, was mich irgendwie nervös macht. Ich esse auf den Stufen noch eine Mandarine oder auch zwei. Dann geht es hinein ins Abteil zur 23-Stunden-Sitzfleisch-Übung.
Von Formschwächen und Siegesserien
Mittags hat der US-koreanische Kollege Elliot Lee die Deutsch-Lehrer und mich in die neue Patrizier-Mensa bestellt, die sich in einer Art gläsernem Aussichtsturm befindet: fantastische Aussicht auf das Tal mit der Stadt. Elliot selbst hat dann aber gar keine Zeit und taucht erst zum Nachtisch auf. Als Entschädigung spendiert er uns Eis.
Am Nachmittag um vier findet dann der große Vortrag statt, der diese Reise zur Dienstreise macht: „Leben und Studieren in Deutschland“. Ich habe die Veranstaltung spontan in Absprache mit dem Fachbereich Deutsch anberaumt und dafür gestern Abend noch ein Dutzend Plakate ausgehängt. Vierzig Studenten und Studentinnen sitzen mir in Raum 210 gegenüber, in dem ich früher fast täglich unterrichtet habe, allerdings fast alle aus dem Fachbereich Deutsch. Der unbestechliche Dr. Gross, der selbst Studenten hat, die in Deutschland studieren wollen, durchschaut, dass ich den Vortrag nicht geprobt habe und äußert schon in Zwischenfragen Unbehagen ob mancher unexakten Explikation. Die Fachbereichsleitung bedankt sich trotzdem für den informativen Vortrag. Ein Theologie-Student hat nach dem Vortrag noch eine Reihe von Fragen, die ich im Büro im Einzelgespräch zu klären versuche.
Dann stehe ich auch schon vor dem Eingang zum Xin Guo Mao, dem großen Einkaufstempel. Die Straßen sind in Yanji bereits auffällig leer. Hier ist Provinz. Und der Wind kühlt mich schon wieder merklich aus. Während ich warte, erinnere ich mich daran, dass Chunji, einige andere Studentinnen und ich uns im Juli 2007 mit maximaler Wirkung in Peking verpasst haben, obwohl wir vermeintlich beide zur verabredeten Zeit unter dem Mao-Bild am Eingang zur Verbotenen Stadt gewartet haben. Aber dann sehe ich sie schließlich auf mich zukommen. Chunji wieder in diesem weißen Damen-Mantel, den sie schon gestern anhatte, neben ihr Li Yan, die damals viel runder im Gesicht war. Wir gehen zu Kentucky Fried Chicken, einem typisch chinesischen Restaurant, und tauschen eine knappe Stunde aus, was wir in den letzten vier Jahren gemacht haben. Dann muss Li Yan zurück nach Hause. Morgen ist ja der Abflug. Ich verspreche Chunji, mich im November zu melden, wenn ich in Peking bin. Dann geht es zurück zur Casa Dana, wo mein Gastgeber und ich bis in die Nacht Der große Wurf spielen. Dana verliert alle drei Runden, ich spiele wie im Rausch und würfle in einem Spiel gleich zwei Super, wahrscheinlich als Ausgleich für den lauen Vortrag. Zu schade, dass ich nicht mehr Gegner habe!
Noch ein Unfall
Eigentlich sollte es zum Mittagessen Spaghetti geben. Eingeladen hat der einzige noch verbliebene Deutschlehrerkollege von einst, Helmut Linke, und zwar mich und die Ex-Studentin Chunji alias Silvia. Es sollte also Spaghetti geben, doch da das Geheimnis wie so oft auch hier in der Soße liegt und die Helmut angebrannt ist, gibt es als Alternative Pfannkuchen. Chunji ist die Allzeitbeste aller Deutsch-Studenten, die YUST jemals von innen gesehen haben. Dass sie in Yanji bleiben wollte, obwohl sie an einer Elite-Uni ebenfalls Karriere hätte machen können, gibt mir noch heute Rätsel auf. Denn jetzt ist sie ja doch von ihren Eltern getrennt, wohnt in Peking und ist nur auf Ferien hier. In Kürze wird geheiratet. Helmut findet das gut: Er ist strikt dagegen, dass sich Frauen in Karriereberufen verwirklichen, weil das seines Erachtens der von der Bibel vorgezeichneten Rolle der Frau widerspricht. Chunji ist etwas damenhafter geworden, was ich ihr nicht verschweige. Sie lächelt bescheiden wie immer. Ich habe Chunji 2006 zuletzt in Deutschland gesehen, wo sie ein halbes Jahr lang auf der Bibelschule Klostermühle bei Bad Ems gelernt hat. Ich bringe sie, als Helmut zum Unterricht muss, noch zum Bus. Unterwegs verabreden wir uns für morgen Abend, denn dann kann ihre seinerzeit beste Freundin Li Yan, die in Berlin Deutsch als Fremdsprache studiert, vor ihrer Abreise auch noch mal kurz Wiedersehen mit ihrem Ex-Lehrer feiern.
Am heutigen Abend sind aber erst mal die Kollegen dran: Dana, Helmut und Richard werden von mir zum Abendessen eingeladen (kommt auf die Spesen-Rechnung). Das Große-Mauer-Restaurant war damals schon beliebter Treffpunkt. Wir essen so viel, dass wir alle freiwillig zu Fuß zurück zur Uni gehen.
Schreck in der Abendstunde
Am Morgen im englischen Gottesdienst, der nach alter Tradition im fünften Stock des zweiten Lehrerwohnheims stattfindet, bin ich so etwas wie der zurückgekehrte verlorene Sohn. Allerdings sind nicht mehr viele da, die mich vermissen konnten. Fluktuation nennt man das. Einer, der mich noch kennt, ist der Physiker Dr. Gross aus dem Schwabenländle. Nachmittags spaziere ich mit ihm übers Land. Wir stoßen auf eine breite Trasse für eine neue Straße und fragen uns, was für eine Autobahn das mal werden soll hier mitten in der Walachei. Als wir zurück sind, dämmert es schon.
Dann macht es BUMM und wir werden leicht nach vorne geschleudert. Was parkt der Wagen vor uns auch auf einmal mitten auf der Straße? Der Besitzer eines nagelneuen Kraftfahrzeugs, der uns zum Bibelkreis unten in der Stadt bringen sollte, ein Chinese, der an der YUST Obst verkauft und gelegentlich Fahrdienste anbietet, ist ihm hinten drauf gefahren. Wir alle, die wir hinten mit drin sitzen, Helmut, Dana, Elisabeth und ich, haben das Unheil kommen sehen, aber wir haben ja keine Bremsen unter den Füßen. Jetzt stehen wir im Dunkeln neben der Straße, die Motorhaube ist zerknautscht und neben uns bildet sich eine Öllache. Zum Lachen ist indes jetzt niemandem zumute. Unser Fahrer blickt tapfer drein. Er hat wahrscheinlich sein halbes Leben investiert, um sich den Traum des neuen China erfüllen zu können: ein nagelneues Auto, silber-metallic. Jetzt hat der Traum eine eklige Delle und wir müssen mit dem Taxi weiter. Die Englisch-Lehrerin Gloria hat eingeladen. Die zierliche, aber ungemein dynamische und lebhafte junge Frau hat ihren Mann auf den Philippinen zurückgelassen und ist jetzt im Auftrag des Herrn in Yanji tätig. Sie unterweist Studenten in Englisch und vermittelt nebenbei Grundkenntnisse in Religion; das großzügig geschnittene Wohnzimmer, in dem wir sitzen und uns von Glorias philippinischen Spezialitäten verwöhnen lassen, dient tagsüber als Unterrichtsraum. Zwei junge Inder sind anfangs beim Essen und auch beim Singen mit dabei, eine Medizinstudentin aus Kenia vervollständigt die bunte Runde. Den Indern gefällt „Slumdog-Millionär“. Ich habe sie natürlich sofort auf den diesjährigen Oscar-Abräumer angesprochen. Beim Gebet nehmen sie dann aber beide Reißaus; so weit sind sie noch nicht. Zum Schluss gibt es noch eine Torte, denn Glorias Gatte hat heute Geburtstag. Da ist er zwar nicht. Aber dafür sind wir ja da.
Mondfest
Heute drehe ich noch mal die alte Runde durch die Dörfer im Tal, meine alte Joggingstrecke. Es hat sich was verändert: Die Lagerhalle, an dessen bloßem Fundament ich so oft vorbeigelaufen bin, hat inzwischen Dach und Wände. Ein Wald ist futsch, da steht jetzt eine Kaserne. Aber die Obstbaumplantage ist noch da. Ein Landwirt reicht mir eine leckere Birne und versichert mir: Die ist reif! Es ist ganz schön kalt hier oben im Norden. Ich habe keine Jacke mitgenommen und trage in diesen Tagen zumeist mein gesamtes Gepäck am Leib. Am Abend hat der koreanische Professor Tsching eine Reihe von Alleinstehenden zu sich geladen. Dana ist dabei, Richard auch und ein paar junge Damen aus der Englisch-Abteilung. Die Frau von Herrn Tsching hat allem Anschein seit heute Morgen am Herd gestanden. Das Ergebnis ist eine bunte Palette von Köstlichkeiten. Anlass ist nicht etwa der heutige deutsche Nationalfeiertag, sondern das chinesisch und wohl auch Koreanern nicht fremde Mondfest. Traditionell isst man in China an diesem Tag Bohnenpaste-Kuchen, die sich im Magen anfühlen, als hätte man Teer geschluckt, der langsam hart wird, und die in feudalen, total überteuerten Geschenkverpackungen veräußert werden, gegen die das chinesische Propagandaministerium gerade eine Medienkampagne gestartet hat, weil der unnötige Verpackungsmüll die Umwelt belastet. Auf die Kalorienbomben können wir heute Abend dank Frau Tsching sowieso verzichten.
|
Kostenloses Blog bei Beeplog.de
Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.
|
|
|