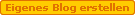| |
Auf dem Campus 'ne Menge los
Und noch eine Jubelparty. Die Universität feiert ein Doppeljubiläum: den 20. Jahrestag der Gründung des Deutsch-Chinesischen Instituts für Rechtswissenschaft sowie 25 Jahre Hochschulpartnerschaft zwischen den Universitäten Göttingen und Nanjing. Rot-gelbe englisch-chinesische Spruchbänder über der Campus-Hauptstraße künden von dem Großereignis.
Im altehrwürdigen Auditorium, in dem wir schon „Leonce und Lena“ beigewohnt haben, finden heute Vertragsverlängerungen und Ansprachen sowie eine Podiumsdiskussion statt. Hao Hui alias „Inge“ schwirrt auch schon wieder herum: Sie ist diesmal für die Ausgabe der Übersetzungsempfangsgeräte (sieht aus wie ein Weltempfänger, funkt aber nur auf einer Frequenz und auf der höre ich meine beiden Kollegen aus der weißen Box neben der Bühne, die an die Kabinen aus dem großen Preis erinnert, die immer hermetisch abgeriegelt wurden, bevor Wim Thoelke Umschlag 1, 2 oder 3 zückte) zuständig und händigt mir eins aus. Dann kommen die üblichen Ansprachen. Aber wer genau hinhört, der merkt, dass Ex-Botschafter Ma Canrong, der höchstrangige Gast auf chinesischer Seite, klare Anweisung aus der Parteizentrale haben dürfte, ein paar kritische Töne hinsichtlich der Querelen um den Auftritt von nicht regimetreuen Autoren auf der Frankfurter Buchmesse (Gastland: China) fallen zu lassen. Gleich zweimal wirft er in einer Podiumsdiskussion, die allerdings mit einer Diskussion nicht mehr Ähnlichkeit hat als die Erde mit dem Mond und eigentlich nur ein Ringvorlesung im Eiltempo ist, den Deutschen in der Runde (Generalkonsul von der Heyden, dem Göttinger Uni-Präsidenten Kurt von Figura, meiner Austauschdienst-Kollegin aus Guangzhou, die ich gestern noch kurz über den Campus geführt habe, und einem Wirtschaftsvertreter von BASF) den Fehdehandschuh hin und kritisiert die feindselige Berichterstattung über China in den deutschen Medien, die „ein großes Problem“ sei, das genannt werden müsse. Die deutschen Vertreter erweisen sich als brave Lämmer: Nach dem Motto: „Ich will ihn nicht, nimm du ihn!“ kommt nach dem zweiten Fehdehandschuhwurf lediglich noch eine diplomatisch verklausulierte Replik vom Generalkonsul, der verschwommen von der „Bereitschaft“ spricht, in diesem Bereich „auch andere Akzente“ zu setzen (bei der Beschäftigung der Journalisten mit China oder beim Umgang der Regierung mit den Medien?). Mehrfach fällt der Begriff Menschenrecht, immerhin ein Kernthema innerhalb des deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialoges, aber die Verbindung zum Menschenrecht Pressefreiheit bleibt ungenannt. Schließlich noch der Satz: „Natürlich können wir den deutschen Medien nicht vorschreiben, wie und worüber sie berichten“ (immerhin), aber „Rahmenbedingungen“ könnten sich ändern, wobei dann aber wieder nicht klar wird, ob chinesische Rahmenbedingungen gemeint sind oder – Gott bewahre! – deutsche. Man hätte ja, wenn der Ex-Botschafter Ma schon so klar auf die Buchmesse Bezug nimmt, immerhin auch mal diskret darauf aufmerksam machen können, dass es keine Idee der „deutschen Medien“ war, eine Sitzung mit regimekritischen Autoren platzen zu lassen. Darauf sind die chinesischen Vertreter ganz von allein gekommen.
Dann gibt es eine hochwertige musikalische Einlage von adrett gekleideten Chinesinnen und die Misstöne sind vergessen. Draußen vor der Tür des Auditoriums betreuen die Studenten des Abschlussjahrgangs einen Info-Stand. Ich begrüße sie kurz und nehme ein paar Bestechungsgeschenke in Empfang, ehe es zum feudalen Jubiläumsessen ins Nanyuan-Restaurant auf dem Campus geht, wo ich Studentin „Eva“ als Ordonnanz neben den vielen Köstlichkeiten stehen sehe. Ob für sie wohl auch etwas davon abfällt?
Am Nachmittag gibt es verschiedene Workshops. Frau Bogner von der Universität Göttingen diskutiert mit Professoren und Studenten über den neu eingerichteten Doppelmagisterstudiengang Interkulturelle Germanistik und gleichzeitig wird erkennbar, dass bei den deutschen Vertreterinnen, die bis auf eine Ausnahme etwas gefunden haben, was ihnen an diesem Samstagnachmittag wichtiger war als an einer Sitzung ihres Fachbereichs teilzunehmen, im Bereich des interkulturell angepassten Verhaltens noch Defizite zu beklagen sind. Man benötigt nicht viel Fantasie um sich vorzustellen, was da vorgefallen ist: Die Studentinnen wurden wie üblich erst drei bis vier Tage vorher von der Zusammenkunft unterrichtet und haben sich ob des Termins am Samstagnachmittag gesagt: „Die Chinesen brauchen wohl noch etwas Nachhilfe, was die Bedeutung des Wochenendes für deutsche Studenten betrifft.“ Interkultureller geht es gar nicht mehr als in diesem Fallbeispiel: Wo chinesische Studenten nichts anderes als einen Pflichttermin wahrnehmen können und auch noch Aufgaben zugeteilt bekommen, tippen sich Deutsche nur verständnislos an die Stirn. Wenn interkulturelle Kommunikation funktionieren würde, dann wären die Deutschen zugegen und auch Institutsleiterin Yin hätte sich eigentlich nicht wundern dürfen: „Warum sind die Deutschen nicht hier? Die sollen doch teilnehmen!“ Die einzige Deutsche, die gekommen ist, entpuppt sich dann auch noch als Polin.
Anschließend gibt es auf der internen Lehrerkonferenz der Deutsch-Abteilung einen Disput zwischen zwei professoralen Lagern, dem ich nicht ganz folgen kann. Ich esse in der Zeit Mandarinen vom Buffet.
Am Abend laufe ich einer schwer atmenden Huang Hua über den Weg. „Herr Mehrens!“, ächzt sie. Sie trägt zusammen mit Liu Min eine schwere, schwere Kiste über den Campus; es handelt sich um die Lostrommel der Verlosaktion anlässlich des Jubiläums (Hauptgewinn: eine Woche Deutschland). Sie sei zu klein, klagt sie. Oder einfach zu schwach?, erwidere ich. Ich meine natürlich: zu geschwächt nach so einem arbeitsreichen Tag als Hilfskraft auf der Jubelparty, nehme den beiden die Kiste sofort ab und trage sie bis ans Ziel.
Heiraten für Anfänger
Die nächsthöhere Stufe wäre dann Spießrutenlaufen, denn nur Spießrutenlaufen ist noch schlimmer als eine Hochzeit in China (aus Sicht des Bräutigams). Der Ehemann der Vizedekanin hat seine Frau und mich freundlicherweise in dem Party-Restaurant abgesetzt. Er selbst nimmt nicht teil, weil es sich ja nicht um seinen Kollegen handelt, der da heiratet. In Deutschland ziemlich unvorstellbar. Im Saal dominieren weiß, rosa und andere Bonbonfarben das Bild. Links und rechts der Bühne laufen Filmausschnitte über das traute Paar, dazu Musik. Das Mikrofon des Conférenciers, des Mannes in Weiß, ist genau so laut, dass es gerade nicht mehr erträglich ist und man sich am liebsten fortwährend die Ohren zuhalten möchte. Das traute Paar marschiert ein wie Gladiatoren in die Kampfarena. Vorher muss der Bräutigam, ein junger Kollege, aber erst noch beweisen, dass er Spaß versteht und auch bei „China sucht den Superstar“ gut im Rennen läge: Er muss über einen leuchtenden Laufsteg aus Glas und singen, als gelte es nicht das Herz seiner Braut, sondern den ersten Platz bei besagter Fernsehshow zu erobern. Hinzu kommen im Laufe des Abends noch eine Reihe von Geschicklichkeitsprüfungen, bei denen ich wahrscheinlich überall durchgefallen wäre. Die Braut hat es auch nicht leichter: Im Laufe des Abends muss sie sich in drei verschiedenen Hochzeitskleidern präsentieren.
Dann sind die Gäste an der Reihe: Freiwillig dürfen die an einer Modenschau-Imitation mitmachen. Einer Dame mit beträchtlicher Leibesfülle und noch beträchtlicherem Charme fliegen die Herzen der gut gelaunten Gäste nur so zu, die gertenschlanke Bald-Ehefrau eines Kollegen, die meiner Ansicht nach ja die buchstäblich bessere Figur gemacht hat, schafft es in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen nur auf Platz zwei. Abgestimmt wird wie einst bei Wetten dass..? durch Gejohle und Applaus. Für Kinder gibt es Plüschtiere zu gewinnen, die zweimal so groß sind wie sie selbst und wem das noch nicht genügt, für den gibt es ein Zwanzig-Gänge-Menü. Zwischendurch das obligatorische Ganbei mit den Kollegen an den Nachbartischen. Wer nicht anstößt, stößt wenigstens ab und zu auf, zum Beispiel ich mit meiner notorischen Cola im Glas, über die ein weinseliger Kollege schon wieder die Nase rümpft. Und nach drei Stunden ist der Spaß dann auch schon wieder aus und die Gäste gehen nach Haus.
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
Peter, mein Tennispartner hat eine internationale Wandertruppe zusammengestellt und bestellt mich für ein Uhr zum Pipa-See am Fuße des Purpur-Bergs. Mit Bus Nr. 6 soll ich da gut hinkommen können. Aber ich renne erst mal in die falsche Richtung und lande in einem verlassenen Resort, das schon bessere Tage gesehen zu haben scheint. Dann finde ich den Durchlass durch die Mauer, von dem Peter schrieb, doch noch. Aber es ist schon fünf nach eins. Ich wandere erst mal auf Verdacht los und denke, dass ich auf so eine Horde westlicher Jugendlicher schon aufmerksam werde, wenn sie mir über den Weg läuft. Und dass ich sie im Anbetracht meines beträchtlichen Wandertempos irgendwann überholen müsste, falls sie schon vor mir sind, scheint mir so klar wie Kloßbrühe. Schließlich sind in der Gruppe auch Mädchen... Spätestens auf dem Gipfel würde ich sie ja treffen, so meine Logik, denn der ist ja das offenkundige Ziel des heutigen Wandertages. Ich wandere also querfeldein, springe mal wieder über Zäune und Absperrungen, die mir im Weg sind und bin um drei auf dem Gipfel des Berges. Ich habe auch mal kurz Pause gemacht unterwegs, habe ich sie deshalb unterwegs nicht getroffen? Oder sind sie einfach auf anderen Pfaden unterwegs als ich. Eine halbe Stunde sehe ich mich auf dem Gipfel um und schaue mir bei klarer Sicht Nanjing von oben an, Aug in Auge mit dem neuen Zifeng-Turm, der übrigens genauso hoch ist wie der Purpur-Berg (448 Meter). Zwei Französinnen und noch ein paar Ausländer laufen mir auf dem wie immer viel bevölkerten Gipfel-Areal über den Weg und ich bin von jeder schwarzen Brille wie elektrisiert, da Peter so ein auffälliges Gestell trägt, aber vom echten Peter keine Spur. War ich wirklich so langsam? Ich wende mich etwas frustriert den Betonstufen zu und beginne den Abstieg. Gott hört auch keine Gebete mehr, denn ich hatte doch erbeten, dass er mir ein bisschen hilft, die Truppe zu finden. Ich bin keine Minute unterwegs nach unten, ein paar unbekannte Amerikaner haben mich gerade passiert, da blicke ich einem ungläubigen Peter ins Angesicht, der mich sofort stürmisch umarmt wie der Vater den verlorenen Sohn in Lukas 15. Er hatte natürlich nicht mehr mit mir gerechnet. Ich schließe mich der nicht gerade kleinen Gruppe an, die gleich drei Bens enthält, ich muss mir also nicht viele Namen merken. Ein Chinese namens Daniel fängt gleich auf dem Gipfel an Gottes Schöpfung zu preisen. Einer der Bens ins Anglo-Franzose. Er hat eine junge Studentin aus Guangzhou an seiner Seite, die sehr gutes Englisch spricht. Er selbst ist ein Abenteurer ersten Grades, hat sich vorher in Thailand und Indien herumgetrieben, soll eigentlich in Frankreich studieren, hat aber kurz vor Beginn des Semesters Reißaus genommen und nun ist er hier, unterrichtet Englisch, hat aber viel Stress und muss viel um Anerkennung kämpfen, weil er eben keinen Abschluss hat.
Ich bin heute also zweimal ganz oben, einmal allein, einmal als Gruppenwanderer. Wir kommen erst spät, bei Einbruch der Dunkelheit, ins Tal zurück und landen an einem anderen See, dem Zixia-See, in dem einige verwegene Chinesen sogar zu schwimmen wagen. Ben aus Frankreich holt in einem Park am See, der vorläufigen Endstation, seinen Frisbee heraus, der andere Ben spricht ein Dankgebet, dann ist es dunkel und auf einmal unglaublich kalt. Wir haben ja keinen Sommer mehr. Und ich war auf so einen langen Tag nicht vorbereitet. Frierend folge ich der Gruppe. Peter geleitet uns in ein Restaurant. In der Stadt, die gleich hinter der nächsten Ecke beginnt, ist es sogleich fünf Grad wärmer. Daniel und ich suchen ein Klo und müssen gleich noch mal fünf Minuten wandern gehen – bis zur nächsten Tankstelle. Wir essen Nudelsuppe und Xiaolongbao. Dann setzt Peter uns in die richtigen Busse. Ben aus Frankreich findet, ich bin ein cooler Typ, und ich solle mich mal melden. Seine Freundin aus Guangzhou, die im Bus neben mir sitzt, bittet mich sogar, sie mal an ihrer Uni zu besuchen. Na, daraus wird wohl nichts. Wandertag Ende.
Völkerverständigung mit kleinen Fehlern
Heute treffe ich mich mit Constanza aus Buenos Aires. Ich hole sie vom Uni-Bus ab, zeige ihr meine Bibliothek und gehe mit ihr Xiaolongbao essen, das sind chinesische Riesenravioli mit Suppe zwischen Fleischfüllung und Teig, die rausspritzt und die Hose einsaut, wenn man falsch reinbeißt. Constanza, die heute eine langweilige Spangensteckfrisur hat, erzählt von ihrem Vater, einem Wäsche-Macho, der nur seine eigene Wäsche wäscht und nie die von anderen, von ihrem Jahr als Lehrerin in Japan, von ihrer Reise nach China, auf der sie nach Nanjing kam, und sich überlegte: Hier müsste man auch mal ein Jahr hin. Sie erzählt weiter, dass dann ohne weiteres Zutun plötzlich dieses Angebot an ihrem Institut ankam, für ein Jahr in der Spanisch-Abteilung der Uni Nanjing Geschichte zu unterrichten – der Mensch denkt, Gott lenkt. Nach dem Essen führe ich sie auf den wunderbaren Campus der Nachbaruniversität, der so genannten Nanjing Normal University, wo es einen Ententeich ohne Enten gibt. Eine Frauentruppe, wahrscheinlich ein Ehemaligentreffen, lässt sich von uns ablichten, d.h., mit dem von mir gemachten Foto waren sie nicht so zufrieden, also musste Constanza ran. Ich lichte dafür Constanza vor einigen altehrwürdigen Uni-Gebäuden ab. Mit meinem Spanisch bin ich trotz einiger Mängel im Wortschatz ganz zufrieden und hoffe Constanza, die sich schließlich bei mir noch wie abgesprochen Pans Labyrinth und Zerrissene Umarmungen ausleiht, hat bald wieder Zeit. Irgendwie nervt es aber auch, dass ich Spanisch immer noch besser (vor allem verstehen) kann als Chinesisch. In spanischsprachigen Ländern war ich insgesamt vier Monate, in China über 40 Monate. Ich müsste also eigentlich zehnmal so gut Chinesisch können wie Spanisch.
Am Abend dann die große Pleite: Das von mir initiierte Treffen zwischen chinesischen Deutsch-Studenten und deutschen Chinesisch-Lernern muss fast ohne Deutsche auskommen. Irgendwie muss ich die Sache vergeigt haben. Letztes Jahr kamen die Deutschen in Scharen und wie von allein. Diesmal hat das Versenden einer E-Mail an alle Deutschen, deren Adressen mir vorlagen, und das Hoffen auf Mundpropaganda offensichtlich nicht die erhoffte Wirkung erzielt. Nur zwei Deutsche kommen und eine von ihnen ist Polin. Reihenweise ziehen enttäuschte Studenten ab, der Jahrgang 08 vertreibt sich mit ein paar Spielen den Frust und zwei Stunden später sind nur noch ein paar Schach-Könige übrig. Im Nebenraum vertilge ich Pizza und Pommes und meine Studentinnen des Jahrgangs 07 nutzen die Gelegenheit um zu fragen, was sie schon immer über ihren Lehrer wissen wollten, aber sich bisher nicht zu fragen trauten: warum ich nicht verheiratet bin, ob ich in Deutschland eine Freundin habe, die auf mich wartet, und warum ich immer mit denselben langweiligen Klamotten herumlaufe. Sie wissen, wie viele Paar Schuhe und wie viele Hosen ich besitze. Sogar ein fehlender Knopf auf einem meiner Hemden ist ihnen aufgefallen. Bei Lehrern komme es doch auf den Inhalt an, wehre ich mich, nicht auf die Verpackung. Aber langweilige Verpackung sei demotivierend, werde ich ausgekontert. Zum Glück setzt sich Zhiyu vom Jahrgang 08 zu mir. Er trägt immer dasselbe Adidashemd (er hat zwei davon, also ist es nur das gleiche Adidashemd) und wir einigen uns darauf, dass Frauen derart pragmatische und von der Vernunft gesteuerte Verhaltensweisen einfach nicht verstehen können. Besonders überrascht bin ich von Eva, der Frau, deren Koffer ich unlängst zerstört habe. Sonst schweigsam wie eine versiegte Quelle sprudelt sie heute wie ein Wasserfall. Conny, die im Sommer mit Eva in Heidelberg war, weiß das zu erklären: Eva habe kürzlich zum ersten Mal in ihrem Leben Bier getrunken. "Na", sage ich, "die Wirkung hält aber lange an!"
Obwohl die Stimmung doch ganz gut war, gehe ich ziemlich verdrossen nach Hause, weil das Ziel dieser Zusammenkunft verfehlt wurde. Denn das Ziel war ja nicht, mir Löcher in den Bauch zu fragen.
Gipfelsturm
Und nun muss ich auch schon wieder abreisen. Ich nehme den Zug um 12.35 Uhr, der am nächsten Tag um halb 12 in Peking sein wird. Die schlechte Nachricht: Wegen des Feiertagsreiseverkehrs habe ich keine Schlafwagenkarte mehr bekommen. 23 Stunden sitzen! Weil das eine Tortur wird, gehe ich vormittags zum Abschluss noch einmal auf den Maoershan, den kuppelförmigen Berg vor der Stadt, der sich ebenfalls beträchtlich weiterentwickelt hat. Die matschige Wanderpiste von einst wurde durch feste Holzstege ersetzt und ich bin von Touristen umgeben. Wo früher zwei, drei Ausflügler sich tummelten, sind es heute zwanzig oder dreißig. Ich steige also die Stufen hinan und auf dem Gipfel ist auch alles anders. Da oben wurde nämlich ein Aussichtsturm im Stile des Ketelvierth-Aussichtsturms errichtet, nur größer, versteht sich. Das macht die Aussicht allerdings entsprechend besser. Von hier oben kann ich nun sogar die Universität sehen. Beim Abstieg wollte ich eigentlich meine Gedanken etwas schweifen lassen, aber ein kahlköpfiger Chinese zwingt mir ein Gespräch auf, will mal wieder gleich wissen, wo meine Familie sei und so weiter. Ich erkläre zum 100.000sten Mal, dass ich das mit dem Verheiratetsein nicht so praktisch finde und überhaupt, was soll das? - und werde zum 100.000sten Mal nicht verstanden. Der drahtige Glatzkopf fragt weiter, ob ich wohl homophile Neigungen hätte. Ich verneine, aber ich bin inzwischen nicht mehr ganz sicher, was er selbst für einer ist. Wo sind eigentlich seine Frau und sein Kind? Da kommt auch schon Bus Nr. 48 und erlöst mich. Ich frage nach dem kürzesten Weg zum Bahnhof, muss dann einmal umsteigen, werde nervös, weil der Bus, in den ich gestiegen bin, im Schneckentempo fährt, am Ende reicht die Zeit aber doch noch für ein paar Einkäufe für die lange Zugreise. Direkt vor einem der Läden am Bahnhofsplatz erkennt mich dann ein älterer dürrer Mann als ehemaligen YUST-Lehrer wieder, an den ich mich nun überhaupt gar nicht und nicht die Bohne erinnern kann, was mich irgendwie nervös macht. Ich esse auf den Stufen noch eine Mandarine oder auch zwei. Dann geht es hinein ins Abteil zur 23-Stunden-Sitzfleisch-Übung.
Von Formschwächen und Siegesserien
Mittags hat der US-koreanische Kollege Elliot Lee die Deutsch-Lehrer und mich in die neue Patrizier-Mensa bestellt, die sich in einer Art gläsernem Aussichtsturm befindet: fantastische Aussicht auf das Tal mit der Stadt. Elliot selbst hat dann aber gar keine Zeit und taucht erst zum Nachtisch auf. Als Entschädigung spendiert er uns Eis.
Am Nachmittag um vier findet dann der große Vortrag statt, der diese Reise zur Dienstreise macht: „Leben und Studieren in Deutschland“. Ich habe die Veranstaltung spontan in Absprache mit dem Fachbereich Deutsch anberaumt und dafür gestern Abend noch ein Dutzend Plakate ausgehängt. Vierzig Studenten und Studentinnen sitzen mir in Raum 210 gegenüber, in dem ich früher fast täglich unterrichtet habe, allerdings fast alle aus dem Fachbereich Deutsch. Der unbestechliche Dr. Gross, der selbst Studenten hat, die in Deutschland studieren wollen, durchschaut, dass ich den Vortrag nicht geprobt habe und äußert schon in Zwischenfragen Unbehagen ob mancher unexakten Explikation. Die Fachbereichsleitung bedankt sich trotzdem für den informativen Vortrag. Ein Theologie-Student hat nach dem Vortrag noch eine Reihe von Fragen, die ich im Büro im Einzelgespräch zu klären versuche.
Dann stehe ich auch schon vor dem Eingang zum Xin Guo Mao, dem großen Einkaufstempel. Die Straßen sind in Yanji bereits auffällig leer. Hier ist Provinz. Und der Wind kühlt mich schon wieder merklich aus. Während ich warte, erinnere ich mich daran, dass Chunji, einige andere Studentinnen und ich uns im Juli 2007 mit maximaler Wirkung in Peking verpasst haben, obwohl wir vermeintlich beide zur verabredeten Zeit unter dem Mao-Bild am Eingang zur Verbotenen Stadt gewartet haben. Aber dann sehe ich sie schließlich auf mich zukommen. Chunji wieder in diesem weißen Damen-Mantel, den sie schon gestern anhatte, neben ihr Li Yan, die damals viel runder im Gesicht war. Wir gehen zu Kentucky Fried Chicken, einem typisch chinesischen Restaurant, und tauschen eine knappe Stunde aus, was wir in den letzten vier Jahren gemacht haben. Dann muss Li Yan zurück nach Hause. Morgen ist ja der Abflug. Ich verspreche Chunji, mich im November zu melden, wenn ich in Peking bin. Dann geht es zurück zur Casa Dana, wo mein Gastgeber und ich bis in die Nacht Der große Wurf spielen. Dana verliert alle drei Runden, ich spiele wie im Rausch und würfle in einem Spiel gleich zwei Super, wahrscheinlich als Ausgleich für den lauen Vortrag. Zu schade, dass ich nicht mehr Gegner habe!
Noch ein Unfall
Eigentlich sollte es zum Mittagessen Spaghetti geben. Eingeladen hat der einzige noch verbliebene Deutschlehrerkollege von einst, Helmut Linke, und zwar mich und die Ex-Studentin Chunji alias Silvia. Es sollte also Spaghetti geben, doch da das Geheimnis wie so oft auch hier in der Soße liegt und die Helmut angebrannt ist, gibt es als Alternative Pfannkuchen. Chunji ist die Allzeitbeste aller Deutsch-Studenten, die YUST jemals von innen gesehen haben. Dass sie in Yanji bleiben wollte, obwohl sie an einer Elite-Uni ebenfalls Karriere hätte machen können, gibt mir noch heute Rätsel auf. Denn jetzt ist sie ja doch von ihren Eltern getrennt, wohnt in Peking und ist nur auf Ferien hier. In Kürze wird geheiratet. Helmut findet das gut: Er ist strikt dagegen, dass sich Frauen in Karriereberufen verwirklichen, weil das seines Erachtens der von der Bibel vorgezeichneten Rolle der Frau widerspricht. Chunji ist etwas damenhafter geworden, was ich ihr nicht verschweige. Sie lächelt bescheiden wie immer. Ich habe Chunji 2006 zuletzt in Deutschland gesehen, wo sie ein halbes Jahr lang auf der Bibelschule Klostermühle bei Bad Ems gelernt hat. Ich bringe sie, als Helmut zum Unterricht muss, noch zum Bus. Unterwegs verabreden wir uns für morgen Abend, denn dann kann ihre seinerzeit beste Freundin Li Yan, die in Berlin Deutsch als Fremdsprache studiert, vor ihrer Abreise auch noch mal kurz Wiedersehen mit ihrem Ex-Lehrer feiern.
Am heutigen Abend sind aber erst mal die Kollegen dran: Dana, Helmut und Richard werden von mir zum Abendessen eingeladen (kommt auf die Spesen-Rechnung). Das Große-Mauer-Restaurant war damals schon beliebter Treffpunkt. Wir essen so viel, dass wir alle freiwillig zu Fuß zurück zur Uni gehen.
Schreck in der Abendstunde
Am Morgen im englischen Gottesdienst, der nach alter Tradition im fünften Stock des zweiten Lehrerwohnheims stattfindet, bin ich so etwas wie der zurückgekehrte verlorene Sohn. Allerdings sind nicht mehr viele da, die mich vermissen konnten. Fluktuation nennt man das. Einer, der mich noch kennt, ist der Physiker Dr. Gross aus dem Schwabenländle. Nachmittags spaziere ich mit ihm übers Land. Wir stoßen auf eine breite Trasse für eine neue Straße und fragen uns, was für eine Autobahn das mal werden soll hier mitten in der Walachei. Als wir zurück sind, dämmert es schon.
Dann macht es BUMM und wir werden leicht nach vorne geschleudert. Was parkt der Wagen vor uns auch auf einmal mitten auf der Straße? Der Besitzer eines nagelneuen Kraftfahrzeugs, der uns zum Bibelkreis unten in der Stadt bringen sollte, ein Chinese, der an der YUST Obst verkauft und gelegentlich Fahrdienste anbietet, ist ihm hinten drauf gefahren. Wir alle, die wir hinten mit drin sitzen, Helmut, Dana, Elisabeth und ich, haben das Unheil kommen sehen, aber wir haben ja keine Bremsen unter den Füßen. Jetzt stehen wir im Dunkeln neben der Straße, die Motorhaube ist zerknautscht und neben uns bildet sich eine Öllache. Zum Lachen ist indes jetzt niemandem zumute. Unser Fahrer blickt tapfer drein. Er hat wahrscheinlich sein halbes Leben investiert, um sich den Traum des neuen China erfüllen zu können: ein nagelneues Auto, silber-metallic. Jetzt hat der Traum eine eklige Delle und wir müssen mit dem Taxi weiter. Die Englisch-Lehrerin Gloria hat eingeladen. Die zierliche, aber ungemein dynamische und lebhafte junge Frau hat ihren Mann auf den Philippinen zurückgelassen und ist jetzt im Auftrag des Herrn in Yanji tätig. Sie unterweist Studenten in Englisch und vermittelt nebenbei Grundkenntnisse in Religion; das großzügig geschnittene Wohnzimmer, in dem wir sitzen und uns von Glorias philippinischen Spezialitäten verwöhnen lassen, dient tagsüber als Unterrichtsraum. Zwei junge Inder sind anfangs beim Essen und auch beim Singen mit dabei, eine Medizinstudentin aus Kenia vervollständigt die bunte Runde. Den Indern gefällt „Slumdog-Millionär“. Ich habe sie natürlich sofort auf den diesjährigen Oscar-Abräumer angesprochen. Beim Gebet nehmen sie dann aber beide Reißaus; so weit sind sie noch nicht. Zum Schluss gibt es noch eine Torte, denn Glorias Gatte hat heute Geburtstag. Da ist er zwar nicht. Aber dafür sind wir ja da.
Mondfest
Heute drehe ich noch mal die alte Runde durch die Dörfer im Tal, meine alte Joggingstrecke. Es hat sich was verändert: Die Lagerhalle, an dessen bloßem Fundament ich so oft vorbeigelaufen bin, hat inzwischen Dach und Wände. Ein Wald ist futsch, da steht jetzt eine Kaserne. Aber die Obstbaumplantage ist noch da. Ein Landwirt reicht mir eine leckere Birne und versichert mir: Die ist reif! Es ist ganz schön kalt hier oben im Norden. Ich habe keine Jacke mitgenommen und trage in diesen Tagen zumeist mein gesamtes Gepäck am Leib. Am Abend hat der koreanische Professor Tsching eine Reihe von Alleinstehenden zu sich geladen. Dana ist dabei, Richard auch und ein paar junge Damen aus der Englisch-Abteilung. Die Frau von Herrn Tsching hat allem Anschein seit heute Morgen am Herd gestanden. Das Ergebnis ist eine bunte Palette von Köstlichkeiten. Anlass ist nicht etwa der heutige deutsche Nationalfeiertag, sondern das chinesisch und wohl auch Koreanern nicht fremde Mondfest. Traditionell isst man in China an diesem Tag Bohnenpaste-Kuchen, die sich im Magen anfühlen, als hätte man Teer geschluckt, der langsam hart wird, und die in feudalen, total überteuerten Geschenkverpackungen veräußert werden, gegen die das chinesische Propagandaministerium gerade eine Medienkampagne gestartet hat, weil der unnötige Verpackungsmüll die Umwelt belastet. Auf die Kalorienbomben können wir heute Abend dank Frau Tsching sowieso verzichten.
Didus auf Dienstreise oder: Auweia!
Heute düse ich nach Yanji. Zwischenstopp in Peking. Dort bleiben mir fünf Stunden Zeit (ich habe extra einen früheren Flug genommen), um am Hauptbahnhof eine Zugkarte für die Rückfahrt nächste Woche zu erwerben und so ganz nebenbei nach Spuren der gestrigen Jubelparty zu suchen. Die gibt es tatsächlich: Auf dem Platz des Himmlischen Friedens stehen die Karnevalswagen in Reih' und Glied, einer für jede Provinz. Man sieht Videoprojektionen auf den Schiffsrümpfen, Miniatur-Himmelstempel auf der Brücke oder eine Nachbildung der Tropenwelt von Hainan an Deck. Ehe ich die Ausstellungsstücke in Lebensgröße abschreiten kann, habe ich mich durch einen endlosen Menschenstrom hindurchzukämpfen. Beide U-Bahnstationen am Platz des Himmlischen Friedens sind gesperrt, an den Aus- und Eingängen gibt es Sicherheitsüberprüfungen, als könnten die Züge fliegen, und die halbe Welt strömt vom nächstgelegenen U-Bahnhof Xidan zum Platz der Plätze. Neu ist dort übrigens auch ein Sun-Yat-sen-Porträt, das exakt gegenüber von dem etwa 200 Meter entfernten berühmten Mao-Porträt am Eingang zur Verbotenen Stadt angebracht wurde. Sie sind die beiden Pole, die Eckpfeiler, des modernen China. Die Botschaft ist klar: Sun Yat-sen, der Republikgründer († 1925), ist genauso wichtig wie Mao und vor allem: viel unverfänglicher, weil unter ihm eben nicht Millionen Chinesen umgekommen sind.
Der Rückweg wird zur Exemplifikation des Begriffs Masse Mensch. Die wegen der Nachtbeleuchtung von Xidan her in Richtung Platz strömenden Massen werden von einer Polizistenkette zurückgehalten, die wirkt wie die Humanvariante des Drei-Schluchten-Damms. Und ich bin nun also der, der stromaufwärts den Damm durchbrechen will. Das Unfassbare geschieht: Eine Schleuse für einen Plastikflaschen-Sammler tut sich auf. Die Polizei öffnet einen Durchgang und ich trete einfach in die Fußstapfen des Mannes vor mir, der sich durch die zwanzig, dreißig Meter lange Menschenwand drängt wie ein nervöses Elektron. Und ich komme mir vor, als sähe ich vor lauter Menschen die Masse nicht. Obwohl es kühl geworden ist, bin ich schweißnass. Die Zeit wird auch knapp. Ich haste zum Busbahnhof in Xidan. Nervös erkundige ich mich, wie lange in Anbetracht des Staus auf der Chengan-Allee wohl der Bus brauche, und bekomme die niederschmetternde Antwort: vielleicht neunzig Minuten. Dann hätte ich bis zum Abflug der einzigen Maschine nach Yanji noch zehn Minuten. Das kann ja heiter werden! Spontan entscheide ich mich via U-Bahn zur neuen Airport-Express-Linie vorzudringen, obwohl ich die nicht kenne. Doch unten in der U-Bahn: wieder die Masse Mensch! Der junge Schnösel am Eingang akzeptiert meine am Bahnhof erworbene U-Bahnkarte nicht, weil hier eine andere Linie verlaufe. Diskussion zwecklos. Ich schmeiße die wertlos gewordene Karte entnervt weg. Eine neue Karte zu kaufen würde vermutlich in Anbetracht der Menschenschlangen überall an den Automaten noch mal 20 Minuten kosten. In diesem Ameisenhaufen drehe ich gleich durch, der Zeiger ist kurz vor dem roten Bereich. Ich überspringe eine Reling, weil ich sonst wieder durch eine Damm-Mauer müsste; dabei bleibe ich mit dem linken Fuß hängen, rette mich aber ohne zu stürzen auf beide Beine, taumle, es gibt ein paar Ohs und Ahs. Nichts wie weg hier! Ich stehe wieder vor der Busfahrkartenverkaufsstelle. Der Bus soll um halb sieben abfahren. Jetzt ist es fünf vor halb. Ich kaufe die Karte. Als ich mich umdrehe, fährt der Bus gerade ab. Jetzt bin ich dem totalen Irrsinn nicht mehr fern. Ich nehme die Beine in die Hand und renne (mit Gepäck!) dem Bus hinterher, der gerade nach rechts auf die Chengan-Allee abgebogen ist. Ich rufe. Ich renne. Ich hole den Bus ein. Ich bin jetzt genauso schnell, wie der langsam beschleunigende Bus. Ich laufe neben dem Bus her und schlage auf das Blech. Der Bus hält an. Die Tür öffnet sich und schließt sich gleich wieder, weil ich mich zu ruckartig bewegt habe. Der Fahrer macht Zeichen, die ich nicht verstehe. Die Tür geht wieder auf. Ich steige ein.
Ich bin nach nur 35 Minuten am Flughafen, weil der Bus den Stau auf der Chengan-Allee umfahren hat. Ich komme am nagelneuen Terminal 3 an. Aber geht der Flug von hier ab? Den neuen Terminal gab es bei meinem letzten Aufenthalt in Peking vor den Olympischen Spielen noch nicht. Viele bleiben sitzen. Ich denke: Inlandsflüge in Kleinstädte gehen sicher vom alten Flughafen ab. Als ich an Terminal 1 + 2 ankomme, ernüchternde Neuigkeiten: Ich bin falsch, zurück zu Terminal 3. Die Tante am Schalter macht mir Mut: Ich müsse nun ein Taxi nehmen, weil es schon so spät sei. Sie will sagen: In fünfzig Minuten wird mein Flieger bereits über die Piste rollen. Aber ich und Taxis – das klappt doch nie, denke ich. Erst heute Mittag musste ich schon wieder 100 Yuan zum Nanjinger Flughafen zahlen, weil ich es angeblich sonst nicht mehr zeitig geschafft hätte. Und wo gibt es denn hier Taxis? Ich habe keine Zeit zum Suchen und steige einfach in den Shuttle-Bus, von dem mir die Tante an der Infothek abgeraten hat. Wahrscheinlich ist ihr Mann Taxifahrer. Der Bus, in dem ich von Afrikanern umzingelt bin, braucht tatsächlich nur zehn Minuten, die ich allerdings mitzähle, als wäre gerade eine neue Zeitrechnung eingeführt worden, der ich noch nicht traue. Als ich wieder am Terminal 3 ankomme, profitiere ich von dem glücklichen Umstand, dass ich meine Bordkarte schon in Nanjing empfangen habe. Allerdings steht darauf nichts über meinen Flugsteig. Das bekomme ich auch noch raus. Bei der Sicherheitsüberprüfung bleibe ich verhaltensunauffällig und darf durch. Ich gehe, als ich weiß, dass ich es geschafft habe, noch mal kurz aufs Klo und besteige als letzter Fahrgast sage und schreibe 23 Minuten vor Abflug die Maschine. Demnach hätte ich mir ja den Wettlauf mit dem Bus sparen können...
In Yanji bin ich dann das lebende Exempel für „Die Letzten werde die Ersten sein“ und steige am Flughafen als erster Fahrgast in eines der Taxis, die dort in Kolonnen auf den letzten Flug gewartet haben. Der sonst ganz nette Fahrer kassiert bei mir am Ziel zwanzig Yuan Zusatzgebühr ab, gegen die ich mich nicht wehren kann, weil ich kein Kleingeld habe. Ich und Taxis... Es ist spät, ich bin erledigt, ich bin endlich da. Ich schreite in kalter Luft über das Gelände meiner alten Uni. Ich übernachte bei meinem alten Kollegen Dana aus der English-Conversation-Abteilung auf dem Boden seines 20-Quadratmeter-Zimmers. Morgen mehr.
60 Jahre Volksrepublik China - Teil 2
60 Jahre Volksrepublik China. Natürlich begehe ich den Nationalfeiertag würdig. Cathy hat Freikarten für die Kinovorstellung von „Jian Guo Da Ye“ („Die Gründung einer Repbulik“), einem nagelneuen Hochglanz-Propagandafilm mit englischen Untertiteln, der die Richtung für das neue China vorgibt: Mao und Chiang Kai-shek sind im Grunde nur entzweite Brüder und beide Erben des Republikvaters Sun Yat-sen. Am Ende geht es beiden um die Einheit Chinas, weshalb der geschlagene Chiang überraschend edelmütig (das hat man in China schon anders gesehen) auf eine Fortsetzung des Bürgerkrieges um jeden Preis, z. B. den der Einheit, verzichtet. Mao ist ein jovialer Kettenraucher, der Kinder, wenn die Fluppe mal aus ist, auf sich herumturnen lässt und manchmal auch betrunken lallt. Ein echter Chinese eben. Jackie Chan, Zhang Ziyi und Chen Kaige haben Gastauftritte; es fehlt eigentlich nur Gong Li.
Ich muss mich beim Abendessen von Cathy und ihrer Kollegin nebst Freund verabschieden, denn für zwanzig Uhr habe ich dank der Institutsleitung Freikarten für das große Feuerwerk. Zusammen mit Herrn Weismann und der Autorin Nora Bossong, mit denen ich gestern zum Abschied noch mal den Deutsch-Stammtisch veredelt habe, gehe ich zum Südtor des Xuanwu-Seeparks, wo sich die Wege von Patriziern (mit Karte) und Plebejern (ohne Karte) trennen. Prompt ist das große Gedrängel vorbei. Von einer der Inseln aus haben wir dann tatsächlich einen Vorzugsplatz und können uns das Feuerwerk anschauen, einen spektakulären 45-minütigen Pyromanie-Exzess, der in simulierten Fallschirmen, die schwarz vom Himmel regnen, gipfelt. Das stellt sogar das Millenniums-Feuerwerk in Hamburg A.D. 2000 in den Schatten. Blinde sind heute Abend eindeutig im Nachteil. Ich verabschiede mich von Nora und Herrn Weismann (beide werden abreisen, während ich auf Stippvisite in Yanji bin) und gehe allein heim. Naja, nicht ganz allein. Halb Nanjing hat schließlich versucht, einen guten Platz zu ergattern, um das Feuerwerk zu sehen. (Cathy wird mir nächste Woche berichten, dass sie und ihre Freunde nichts sehen konnten und dass es deshalb Frust-Stress zwischen ihrer Kollegin und deren Freund gab.) Die nächtliche Skyline beherrscht der gerade rechtzeitig zum großen Feiertag fertig gestellte Zifeng-Turm. Hierbei handelt es sich mit 448 Metern um das neunthöchste bereits in Betrieb genommene Bauwerk der Welt, das vierthöchste in China.
Nachts sehe ich mir im Fernsehen noch die zigste Wiederholung der Pekinger Jubelparade an, eine Art Karneval in Köln ohne Köln. Außerdem stehen hier die Politiker, die beim Karneval am Rhein Raketen im Papphintern haben, in Fleisch und Blut auf der Empore und gucken viel ernster. Kein Wunder, ihre Raketen sind schließlich auch nicht von Pappe.
60 Jahre Volksrepublik China - Teil 1
Die Entdeckung des Abends heißt Constanza. Sie trägt eine Brille, deren Gläser in ihrem Gesicht wirken wie Wohnzimmerfenster; der Rest ist eine Mischung aus Penelope Cruz und Anne Hathaway, allerdings die weniger attraktive Ausgabe von Anne Hathaway wie in der ersten Filmhälfte von „Plötzlich Prinzessin“, als Anne noch diese hässliche Brille tragen muss. Anne, ich meine, Constanza, ist aufgewachsen und studierte in Buenos Aires. Jetzt kommt sie gerade aus Japan, wo sie wohl auch unterrichtet hat. Hier an der Nanjinger Uni unterrichtet sie Spanisch-Studenten im letzten Studienjahr in Geschichte. Es macht mir einen Riesenspaß an Constanza meine angestaubten Spanisch-Kenntnisse auszuprobieren. Sie hält mich anfangs, im Bus, der uns zum großen Festbankett anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China bringt, für einen Franzosen und will wissen, aus welcher Gegend in Frankreich ich komme. Sehr schmeichelhaft. Ich verweise auf meinen Sitznachbarn, der wirklich Franzose ist.
Auf drei endlos langen Tischen erwartet uns im großen Saal eines Nobelhotels ein endloses Büffet mit lauter Köstlichkeiten. Schon jetzt steht fest: Heute werde ich wieder essen bis zum Umfallen. Dazu spielen noch traditionelle chinesische Musiker und Musikerinnen, am Ende gibt es ein Solo im Peking- oder Kun-Oper-Stil inklusive Maske. Vorher die Reden. Auch ein deutscher Vertreter von Bosch, der größten deutschen Firma hier in Nanjing, darf eine Ansprache halten. Es hört aber schon seit seinem Vorredner keiner mehr zu. Alles brabbelt durcheinander. Ich muss mich vor die Bühne drängen, um den Worten meines Landsmanns lauschen zu können. Aber es sind ohnehin immer dieselben Floskeln, die in China nie Rost ansetzen. Ein Amerikaner mäkelt: „Der redet ja fast länger als der Chinese vor ihm!“ Recht hat er. Auch über mir schwebt eine Gedankenblase mit den Worten: „Anfangen! Anfangen! Oder es gibt Krach!“
Dann ist die Party aus und alles geht nach Haus. Constanza will sich rasch noch meine E-Mail-Adresse aufschreiben. Ich war so geistesgegenwärtig, die Argentinierin auf ein paar spanischsprachige DVDs hinzuweisen, die sie ja mal ausleihen kann. Und überhaupt.
Auf den Spuren von Tom Cruise
Im Süden der Provinz Zhejiang befindet sich ein malerisches Dorf namens Xitang, das man wie Venedig auch zu Wasser besichtigen kann. Es geht dann unter Brücken hindurch und man hat Blick auf zumeist weiße einstöckige Gebäude, die allerdings heute überwiegend nur noch als Touristenfallen oder Museen (oder beides in einem) dienen. Überall locken Stände mit Leckereien und Souvenirs. Während wir uns für zehn Yuan pro Person mit drei Booten von Sino-Gondolieri durch das Dorf schippern lassen - ich sitze mit Herrn Weismann im selben Boot -, ist die Sicht auf das pittoreske Ufer zumeist verdeckt, da unsere Studentinnen ständig von Deck aus für Fotos mit Hintergrund posieren müssen.
Auf einem kleinen Schiff, das freilich nicht mehr fährt, sondern auf dem Hauptkanal vor Anker liegt, gibt es die Hauptmahlzeit. Nachdem wir gerade vier Stunden lang mit dem Bus angereist sind, muss eine Hungerrevolte niedergeschlagen werden. Frau Yin, die Fachbereichsleiterin, hält eine kurze Rede und erklärt darin, was es mit diesem Sonderfall eines gemeinsamen Ausflugs von Professoren und Studenten für eine Bewandtnis hat: Es handelt sich um eine Belohnung für den besonders erfolgreichen Jahrgang 06, der chinaweit den besten Schnitt in der Prüfung für Deutschstudenten an chinesischen Universitäten erzielt hat. Unter Führung von Xuelian und Xiaoshi besichtige ich hernach noch ein paar der Touristenfallen, darunter ein Knopfmuseum. Dann geht mir das alles zu langsam hier und ich flaniere die verbleibende Stunde vor der erneut vierstündigen Busfahrt alleine durch die Lagunenstadt. Ich hätte am Ende gar nicht so pünktlich zu sein brauchen, denn Yin, mit Herrn Weismann im Gefolge, ist 25 Minuten zu spät. Sonst eher meine Rolle. So kommen wir auch schön in den Wochenendverkehr auf der Autobahn. Naja, ich habe Mau-Mau-Karten dabei. Die vertreiben mir, meiner Vorgängerin Kristina und der Schriftstellerin Bossong, die die längste Niederlagenserie hinlegt, die ich je bei Dreier-Mau-Mau erlebt habe, die Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit. Dann sind wir zwar noch nicht da, können aber keine Spielkarten mehr erkennen.
Wer noch ein etwas genaueres Bild von Xitang haben möchte, der lege eine DVD mit "Mission: Impossible 3" ein. Denn Tom Cruise hat hier 2005 gedreht und für noch mehr Trubel gesorgt, als in Xitang ohnehin schon los ist. Ein großes Plakat vor einem der Restaurants kündet von dem Besucher, der noch prominenter ist als die Uni Nanjing.
Der Didus auf der heißen Blechwand
Da ich ja mittwochs keinen Unterricht habe, beschließe ich heute mal um den Xuanwu-See zu laufen. Sieht etwa so lang aus wie die Außenalster. Aber da es ja nun im Universum hin und wieder doch mal eine Verschwörung gegen mich gibt, ist der Park gerade, ausgerechnet und zufällig heute geperrt. Im Norden gesperrt, wo ich gegen eine Wand laufe, und im Süden, wo ich allerdings genervt durch eine Wand laufe. Da ist nämlich eine Tür in der blauen Blechbarriere. Die Pförtner können gar nicht so schnell reagieren, wie ich da durchlaufe. Sie winken, rufen, ich winke, rufe: "Hallo!" Das muss ich mir ja schließlich sonst auch ständig anhören, dieses "Hallo!" Dann höre ich noch hinter mir schreien: "Stop, stop!" und: "No!" Ich bin aber schon auf und davon. So flitze ich zunächst etwas desorientiert an der Baustelle vorbei, wo sich die Arbeiter schon nicht mehr über mich wundern - die sind am Debattieren und offensichtlich im Dissens über irgendwas -, und habe den Rest des Parks für mich allein. Hin und wieder am Rand mal eine Bepflanzungskolonne oder ein Bauarbeiter. Am Ausgang dann die erwartete nächste Blechwand, daneben wachen zwei Uniformierte. Die denken sicher, der bekloppte Ausländer merkt gleich, dass er in einer Sackgasse steckt, und kehrt um. Alles, was sie aber dann noch von mir hören werden, ist ein Klong-klong, mit dem von der Blechwand springe. Es war da so eine Art Trittleiter im Blech, drei waagerechte Stäbe... Man könnte das wahlweise kommentieren mit der Liedzeile: "Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen" oder mit der Textzeile: "Den running Didus in seinem Lauf hält weder Ochs' noch Esel auf!"
Es müssen doch mehr Kilometer sein als um die Alster, ich krieche nachher nur noch. Und ich muss ja auch einen Umweg nehmen, um nicht schließlich wieder vor der ersten Blechwand zu stehen. Dafür gibt es am Abend eine kräftige Stärkung, denn heute sind alle ausländischen Lehrkräfte zum Buffet geladen. Ich sitze mit Trevor, Nora, Kristina (meiner unmittelbaren Vorgängerin, die für einen Monat an ihre alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist) und unserem gemeinsamen Vorgänger, Ex-Direx Weismann, am Tisch und stelle fest, dass Trevor (fast) so viel essen kann wie ich. "Westler können so was", meint die Fachbereichsleiterin, Chinesen dagegen hätten nach der Uhr zu essen. Um die kümmern wir uns heute gar nicht und stürmen anschließend noch den Deutschen-Stammtisch am Nord-Campus. Nora verlangt nämlich nach Inspiration für ihren nächsten Roman. Trevor darf übrigens auch mit, schließlich war sein Ururgroßvater Deutscher. In einer Redepause von Trevor erzählt Nora, dass sie noch studiert und vielleicht auch noch promovieren will, weil ihr Vater das wichtig findet. Ich sage: "Wer auf Platz drei der SWR-Bestenliste gestanden hat, der braucht keinen Doktortitel mehr." Kurz vor 22 Uhr erinnere ich Herrn Weismann mahnend an die Skype-Verabredung mit seiner Frau daheim. Dankend macht er sich davon und vergisst prompt seine Tasche. Als er sich die später bei mir abholt, berichtet er nicht ohne Verdruss, dass an dem Abend das Internet tot gewesen sei. Nichts war's also mit dem nächtlichen Telefonat. Das ist doch fast so ärgerlich wie Bauarbeiten im Park.
Leonce und Lena
Am Nachmittag trainiere ich die beiden für den diesjährigen nationalen Debattier-Wettbewerb ausgewählten männlichen (!) Studenten zum Thema „Sollten Studenten mehr Mitspracherecht bei Uni-Lehrplänen haben?“
Am Abend ist im Theatersaal der Universität die Premiere des mit Unterstützung des Goethe-Instituts und chinesischen Darstellern inszenierten Büchner-Lustspiels „Leonce und Lena“. Ich sitze in der ersten Reihe, um mitlesen zu können, neben Hao Hui, daneben Jung-Autorin Nora Bossong. Ich habe mir das Stück vorher aus meiner Bibliothek entliehen. Schwierig sind nur die dunklen Szenen, weil das Bühnenlicht dann nicht ausreicht, um lesen zu können. Und von denen gibt es einige. Ein sprödes Stück in einer nicht ganz so spröden Inszenierung, ist mein Resümee, als ich mit Nora nach Hause gehe.
Am nächsten Tag bin ich mit großem Bild, in ein Buch vertieft, von dem niemand weiß, dass es das Theaterstück ist, in der Zeitung abgebildet, wie mir meine österreichische Kollegin Katja brühwarm zu berichten weiß.
Verblüff deine Studenten!
Das habe ich mir letzte Woche, in der ersten Unterrichtsstunde, vorgenommen: Ich werde meine neuen Studenten des Jahrgangs 08, 25 neue Gesichter, total verblüffen. Ich werde innerhalb von einer Woche alle ihre Namen im Gedächtnis abgespeichert haben. Der Trick geht so: Man lässt jeden Studenten seinen Nachbarn vorstellen, fragt beim Namen noch mal nach, schreibt ihn sich auf (ganz wichtig: mit Tonzeichen!) und dazu eine Notiz, an welche bekannte Person einen die Studentin oder der Student erinnert. Falls das nicht möglich ist, eine kurze Beschreibung der Frisur, Brille oder des Hautreinheitsgrads. Zu Hause lernt man dann diese Kombination auswendig wie Vokabeln und das Ergebnis lautet: Verblüff deine Studenten!
China's Next Super Brain
Eigentlich sollte Nora Bossong, die junge Autorin von Webers Protokoll, die für drei Wochen zu Gast an der Uni ist, heute mit auf den Ausflug zum Sun Yat-sen-Mausoleum und dem benachbarten Ming-Grab. Aber ich halte am Treffpunkt vergeblich Ausschau nach ihr. Der Ausflug ist nichts Neues für mich. Die Uni stiftet mal wieder einen Bus und einen Reiseführer und den Eintritt für die Touristen-Hochburgen müssen wir, die ausländischen Lehrkräfte auch nicht entrichten.
Ich muss schmunzeln, als der Reiseführer im Bus das Wetter in Nanjing erklärt und sagt, dass dieser Sommer nicht so heiß ausgefallen sei wie normalerweise. „I don't know why“, sagt er. Er kann nicht ahnen, dass in der internationalen Gemeinde im Juni das gemeinschaftliche Gebet für einen kühlen Sommer ausgerufen wurde („God will give us a cool summer, this year!“) und auch nicht, dass ich mich damals bei dem Gedanken ertappte: „Ja, ja, kühler Sommer, träum weiter, Bruder...“ Zwei Dinge sind aber doch neu heute: Ich stoße diesmal wirklich bis zur Grabstätte des legendären ersten Ming-Kaisers Hong Wu vor, der als Anführer eines Bauernaufstands die Yuan-Dynastie (Mongolen) ablöste, Nanjing zur Hauptstadt Chinas machte und die Epoche der langlebigen Ming-Dynastie (1368-1644) begründete. In Nanjing wollte er auch begraben sein und ließ sich hier daher sein Grab schaufeln, mehr als 15 Jahre vor seinem Tod im Jahre 1398.
Im April, bei meinem letzten Besuch hier, stand ich noch vor einer Baustelle. Neu sind auch die meisten Teilnehmer an diesem Ausflug: Ich lerne den Amerikaner Trevor und drei Franzosen kennen. Trevor scheint irgendwie auch christlich beschlagen zu sein. Sein Vater war Theologie-Lehrer oder so was. Das war sicher noch nicht mein letztes Gespräch mit ihm. Am meisten anfangen kann ich mit Alain Dautricourt, der auch schon um die halbe Welt gekommen ist und zuletzt in Kanada und den USA als Französisch-Lehrer beschäftigt war. Von den beiden anderen Franzosen kommt nur einer zu Wort, der zu der Kategorie Menschen gehört, die es nicht ertragen, wenn sie länger als eine Minute aus einem Gespräch ausgeklinkt sind. Er gibt sich als nicht praktizierender Buddhist zu erkennen und hat auch ein paar Verschwörungstheorien auf Lager, von denen ich aber nicht viel verstanden habe, weil ich mich zwischenzeitlich auch ausgeklinkt habe, gedanklich.
Beim Abstieg vom Mausoleumshügel treffe ich Chinas Next Super Brain: Ein etwas wirrköpfig wirkender Chinese besteht darauf, mir seine achtjährige Tochter vorzustellen, die mich bereits vorher in fast akzentfreiem Englisch angesprochen hat. Dann soll ich mir eine Mathe-Aufgabe ausdenken. Ich sage: „33 plus...“ Da unterbricht mich der Papi und diktiert eine dreistellige Additionsaufgabe mit drei Summanden. Sogleich tickt Chinas Next Super Brain, Papi reicht ihr ein Stück Papier und die Zahl die Chinas Next Super Brain aufschreibt, ist, wie nicht anders zu erwarten war, die gleiche wie auf der Anzeige des Taschenrechners, auf den Chinas Next Super Brain keinen Blick werfen konnte. Ich gratuliere Chinas Next Super Brain und ihrem Manager und muss mich verabschieden, denn unten am Eingang des Mausoleums gibt es das gemeinsame Mittagessen. Neben mir sitzt Alain. Ich kann also weiter Französisch üben.
Dann seile ich mich ab, weil ich am Nachmittag in Michaels neues Heim eingeladen bin. Natürlich ist das großer Unsinn. Ich hätte ja mit dem Reisebus zurückfahren können. Denn die nächste Station ist die Stadtmauer und nicht weit von meiner Wohnung entfernt. Aber warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? Nicht zum ersten Mal überschätze ich mein Orientierungsvermögen und finde erst nicht zur Bushaltestelle. Dann steige ich in Nummer 3, die nach Norden in Richtung Bahnhof fährt. Ich steige viel zu weit nördlich aus, weil ich ja die Busstrecke nicht kenne, und muss eine halbe Stunde in sengender Sonne zu Fuß gehen, um zum Bahnhof zu kommen. Dort stehe ich noch mal eine halbe Stunde am Fahrkartenautomaten, weil heute großer Reisetag ist: Viele Studenten kommen aus dem Urlaub zurück. Die Schlange neben mir löst sich auf, weil der Automat den Geist aufgegeben hat. Und ich bin ehrlich erstaunt, dass das nicht der Automat ist, vor dem ich (gefühlt) seit Stunden anstehe. Ich warte sekündlich darauf, dass auch hier „Out of service“ aufblinkt. Aber es passiert nichts. Ich muss mir das merken für die nächste Situation, in der ich mir einrede, dass alles Dinge des Universums sich gegen mich verschworen haben, nur um mich zu ärgern.

Ich hatte mich bei Michael angemeldet für halb vier. Um 17.20 Uhr bin ich da. Hinter mir liegt der erfolglose Versuch, ein Taxi zu finden. Das Taxi, das schließlich anhielt, konnte mit Michaels Wegbeschreibung nichts anfangen. Ich stelle mal wieder fest: Taxis und ich – das ist einfach eine Mischung, die nicht stimmt. Hinter mir liegt auch eine Fahrt in der Motor-Rikscha, damit ich den Weg von der U-Bahn-Station bis zu Bus Nummer 55/Haltestelle Konfuzius-Tempel auch wirklich finde, den Michael in seiner Wegbeschreibung empfohlen hat. Der Rikschafahrer sieht aus wie blind, kneift seine Augen zusammen zu einem Schlitz, nicht breiter als eine 1-Yuan-Münze, aber er lädt mich am rechten Ort aus. Ich bekomme sogar einen Sitzplatz und muss auf der einstündigen Überfahrt frieren, weil ich direkt unter der Klimaanlage sitze. Beim Ausstieg treffe ich schließlich zwei Damen mit einer Blume, die mich erinnert an die fleischfressende Riesenpflanze aus „Das magische Auge“. Ich frage forsch, ob sie zufällig auch unterwegs seien zu Michaels Party. Eine von beiden versteht mich sogar. Dann gehen wir einmal orientierungslos um den Block mit der Wohnung und schließlich finde ich den richtigen Eingang.
Bei Michael gibt es jede Menge leckeren Kuchen (er verdient ja mit Bäckereien und Leckereien seinen Lebensunterhalt). Die neu bezogene Wohnung ist voll mit Fotos der Hochzeit, die vor ein paar Wochen stattfand und kleinen Gemälden von Michaels neuer Gemahlin, einer Künstlerin, die übrigens fast dreißig Jahre jünger ist als ihr frisch Angetrauter. Michael reicht mir sein Fotoalbum. Seine siebzigjährige Lebensgeschichte versucht Michael gerade in selbst verfassten Memoiren aufzuarbeiten: geboren eine Woche vor Ausbruch des 2. Weltkriegs in Sheffield; von den Leuten auf den meisten Bildern nur noch er am Leben; seine erste Frau Jennifer, die 2003 nicht dazu zu bewegen war, ihrem Mann nach China zu folgen. Ein Seitensprung in ihrer Abwesenheit. Die Scheidung. Michael überließ Jennifer fast seine gesamte Habe. Er schreibt ihr noch heute, bekommt aber nie eine Antwort. Dann die Hochzeit mit der Chinesin Lin oder Ling, die im März dieses Jahres geschieden wurde. Er konnte kein Chinesisch, sie kein Englisch. Ich kann Michael trotzdem ein bisschen verstehen: Dass sein Leben drüben auf der britischen Insel so bunt und abwechslungsreich wäre wie hier, wird wohl niemand ernsthaft behaupten wollen. Vielleicht wäre er auch schon aus Langeweile gestorben. Auf dem kalorienreichen Fest treffe ich u.a. auch Peter, meinen Tennis-Partner, der kürzlich wegen eines Lochs in der Straße verunglückt ist, und Sophia, eine 77-Jährige mit sehr gutem Englisch, die die zehn Kilometer bis zum Zielort auf dem Fahrrad zurückgelegt hat und auch sonst gut beisammen ist. Ansonsten nervt die ältere der beiden Damen aus Bus Nr. 55, die ständig mit doppelter Lautstärke spricht und ständig andere Leute unterbricht. Trotzdem ist sie es, die mich, zusammen mit ihrer Begleiterin, auf dem Rückweg unterhält und auch dafür sorgt, dass ich am Konfuzius-Tempel in den richtigen Bus (Nr. 95) steige. Nora Bossang hat eine SMS geschickt (ich habe seit ein paar Tagen eine chinesische SIM-Karte) und entschuldigt sich mit einem falsch gestellten Wecker.
Bleibt alles anders
Frau Kong, die Vize-Dekanin des Fachbereichs Fremdsprachen, hat mich und meinen Ur-Vorgänger, den pensionierten Hamburger Gymnasialdirektor Weismann, zu einem Diner geladen. Zunächst sind wir bei Familie Kong zu Hause. Auch ihr Mann spricht Deutsch. Er studierte an der FU Berlin. Allerdings ist er einer von denen, die besser verstehen als sprechen können. Nicht nur, dass wir eingeladen sind, es gibt auch noch Geschenke in bunten Tüten. Das ist ja fast so schön wie die Kindergeburtstage früher! Während dort die Geschenke jedoch zumeist kaschierte Rausschmeißer waren, ist das für uns nur das Startsignal zum Aufbruch in das Restaurant drüben um die Ecke.
Danach trennen sich unsere Wege: Ich bin für Herrn Weismann Reiseführer beim Flanieren durch die hochmoderne und bunt schillernde Einkaufsmeile Hunan Lu, das Ehepaar Kong muss die Tochter vom Privat-Unterricht abholen. Der China-Rückkehrer mit dem weisen Namen, der vier Wochen lang den Lehrerkader verstärkt, war vor knapp dreißig Jahren in meiner heutigen Funktion nach Nanjing abgeordnet. Er erkennt nichts mehr wieder. Damals war der einzige Wolkenkratzer das Jingling-Hotel, das heute wirkt wie ein Farn im Fichtenwald. Nur in meiner Bibliothek, in die wir zum Schluss noch einen Blick werfen, regt sich noch der diskrete Muff der Achtziger.
Autoren unter sich
Ich laufe jetzt immer am Mittwoch (mein neuer freier Tag) um die Tennisanlage hinter der Shanghai Lu und meine Patellasehne findet das gut! Ich entlasse mich also mal als (fast) geheilt aus der Lauf-Zwangspause.
Danyu, die mir als dem Beichtvater der Nation inzwischen regelmäßig die lyrischen Botschaften ihrer englischen E-Mail-Liebe als Kopie zuleitet, steht mal wieder vor der Tür und beordert mich in das Café Banpocun in der Qingdao Lu, weil ich unbedingt ihren guten Freund, den Autor Huang Fan kennen lernen soll. Sie selbst ist zu spät und ich unterhalte mich bei Eis und einer Früchteplatte erst mal mit dem drahtigen Dichter mit der Mütze und seinem Kumpel. Beide unterrichten auch Literatur oder Literaturwissenschaft an der Uni. Ich erfahre noch einmal, wie groß die Kluft ist zwischen den handverlesenen offiziellen Autoren, die von der KP protegiert werden und auch dieses Jahr auf der Buchmesse erscheinen dürfen, und Einzelkämpfern wie Huang Fan und Danyu. Huang Fan signiert mir ein Buch, das ich nicht lesen und dessen Titel ich mir nicht merken kann. Positiv ist zu vermerken, dass er, immerhin ein Künstler, nicht raucht und ebenso wie ich kein Freund von VIP-Verkleidungen ist, sondern lieber so rumläuft, wie es ihm gefällt.
Durch den Wind
Danyu ist völlig durch den Wind. Das liegt natürlich an ihrer englischen Internet-Liebe und der Tatsache, dass sie eine Aufnahmeprüfung an der Uni Nanjing machen will, aber eigentlich mit ihren Gedanken immer in Europa ist. Heute Abend überfällt sie mich mit dem Vorschlag eine christliche Gesprächsgruppe zu gründen, aber ich bin skeptisch, weil ich Zweifel habe, ob die Teilnehmer die Bibel zur Grundlage machen wollen. Allgemeines Gelaber über Gott bringt in meinen Augen nichts. Sie redet sich fest und dann stellt sie fest, dass ihre Tasche mit dem Schlüssel für zu Hause in der Bibliothek eingeschlossen wurde, weil es schon so spät ist.
An diesem Abend wird sie noch dreimal bei mir klingeln, zuletzt gegen Mitternacht, weil sie so ratlos ist, denn zu Hause könne sie niemand reinlassen. Ihre Mutter öffne nachts nicht und müsse ja davon ausgehen, dass ihre Tochter es nicht sein kann, die so spät um Einlass bittet. Schließlich habe sie ja einen Schlüssel. Danyu rennt zwischen Bibliothek, mir und ihrem Freund von der Uni hin und her wie ein kopfloses Huhn. Am Ende bittet sie mich, ihr Asyl für eine Nacht zu gewähren. Ein Stuhl sei genug. Das passt mir aber überhaupt nicht. Ich will ihr hundert Yuan für Taxi und Hotel leihen, ihr Geld ist ja auch eingeschlossen. Will sie nicht. Da habe sie Angst, sagt sie. Da kenne sie ja keiner. Das sei so anonym. Du meine Güte, denke ich, die macht mich wahnsinnig! Mit übermenschlicher Geduld palavere ich so lange mit ihr im Treppenhaus, bis ihre Mutter endlich auf dem Mobiltelefon zurückruft und sie nach Hause fahren kann. Ich denke: „Mensch, Mensch, Mensch!“ und denke das auch noch, als am nächsten Tag per E-Mail ihre wortreichen Erklärungsversuche und Entschuldigungen für die Panikattacke einlaufen.
|
Kostenloses Blog bei Beeplog.de
Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.
|
|
|